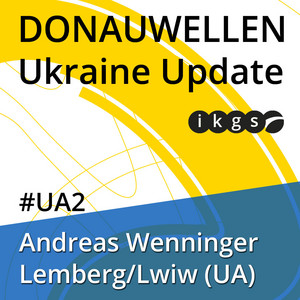Czernowitz 2022. Eine Sommerreise
von Florian Kührer-Wielach
Seit dem Kriegsbeginn im Februar 2022 engagiert sich das IKGS München gemeinsam mit der Universität Czernowitz und vielen befreundeten Institutionen und Personen, finanzielle und materielle Hilfe für die ukrainische Nordbukowina zu organisieren. Im Juli hat Florian Kührer-Wielach, Direktor des IKGS, Czernowitz besucht, um Gespräche zu führen, auf akademischer wie humanitärer Ebene Solidarität zu zeigen und sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Was er dort erfahren und gesehen hat, erzählt er in dieser Reportage.
8. August 2022Zuerst noch ein kurzer Besuch bei Prof. Ștefan Purici, dem Prorektor für die Außenbeziehungen der Ștefan cel Mare-Universität in Suceava. Er ist unser wichtigster Partner in Rumänien, wenn es um Einkäufe und Transporte für die Bukowinahilfe geht. Er hat familiäre Wurzeln in der Nordbukowina, spricht auch Ukrainisch. Mit seiner Position an der Universität Suceava und einer humanitären Stiftung kann er uns auf vielfältige Weise unterstützen. Unsere Großbestellungen, beispielsweise Bettwäsche um mehrere tausend Euro, werden bei ihm in der Universität zwischengelagert. Oft kaufen er und sein Team selbst im Großmarkt ein und bringen die Hilfsgüter bis zur Grenze nach Siret, wo sie von unseren Kollegen aus Czernowitz abgeholt werden.
Mittlerweile ist es möglich, dass die Czernowitzer auch selbst nach Rumänien kommen, um Hilfsgüter abzuholen und einzukaufen. So wird es auch heute sein. Ich werde diesmal mitkommen. Purici hat ohnehin nicht viel Zeit, an der Universität ist admitere, Einschreibungszeit für den neuen Jahrgang. Wir konnten jedoch alles klären, was zu besprechen war. Die Logistik des „Netzwerk Gedankendach“ zwischen München, Suceava und Czernowitz wird weiterhin reibungslos funktionieren. Und was mir noch wichtig war: ihm und seinem Team für die Zusammenarbeit zu danken.
Einkaufen im Großmarkt
Ich treffe die Leiterin des Zentrum Gedankendach Dr. Oxana Matiychuk, ihre Mitarbeiterin Chrystyna Kryliuk aus dem International Office der Universität Czernowitz und Chauffeur Wasyl Samaschko direkt beim Selgros-Großmarkt. Der liegt praktischerweise nicht weit von der Universität entfernt. Die Wiedersehensfreude ist groß, wir haben aber wenig Zeit für Sentimentalitäten, der Einkauf muss erledigt werden und dann sollen wir noch Rollstühle und Windeln abholen, erfahre ich. Wir füllen drei Einkaufswägen mit Lebensmitteln, darunter auch Süßes für die Kinder. Die Qualität der Waren ist in Rumänien besser und tatsächlich ist es hier auch günstiger als in der Ukraine. Die Dame an der Kasse bleibt geduldig, obwohl sie jeden Müsliriegel einzeln abzählen muss und zu allem Überdruss das Kartenzahlsystem ausgefallen ist. Sie weiß offensichtlich, welche Gruppe hier vor ihr steht. Morgen werden die Besorgungen ins Czernowitzer „Studentendorf“ gebracht werden. In den Heimen dort leben im Moment vor allem Flüchtlinge.

Nachdem wird den Inhalt der drei krachvollen Einkaufswägen auf den Kleinlaster gehievt haben, wirkt die Ladefläche noch immer ziemlich leer. Sie wird sich im Laufe des Tages füllen. Wir setzen uns in die Fahrgastkabine. Vorne auf dem Armaturenbrett ist ein Minifahnenständer angebracht. In der Mitte das Fähnchen der Universität Czernowitz, aus der zweiten Reihe gesehen links die Farben der Ukraine, rechts jene der Bukowina. Noch fahren wir aber nicht los. Wasyl klappt ein Tischchen auf, das zwischen erster und zweiter Sitzreihe montiert ist. Seine Frau hat gekocht, wir sollen ordentlich essen, er dürfe nichts zurückbringen. Es gibt pikante Palatschinken und gebackene Zucchini. Tee aus kleinen Krügen, ein schöner Moment.
Oxana fragt mich, ob denn jemand ein Behältnis für den Müll mithabe. Ich krame eine ganze Rolle kleiner Tüten hervor, selbstverständlich biologisch abbaubar. Biomülltüten im Rucksack vorzuhalten, das kann nur der „Wessi“ liefern. Mein halbernst gemeinter Hinweis, dass ich als gelernter Österreicher durchaus in der Lage sei, auch mal zu improvisieren, läuft Mangels an Beweisen ins Leere.
Zuladung in Rădăuți
Wir fahren los Richtung Grenze, machen aber noch einen Abstecher in die Kleinstadt Rădăuți. Dort sollen Rollstühle warten. Seit wir in Suceava losgefahren sind telefoniert Chrystyna, die aus der rumänischen Minderheit in der Ukraine stammt, nahezu durchgehend und geduldig mit verschiedenen Stellen in Rumänien. Sie kämpft um die Genehmigung, die Rollstühle einladen und mitnehmen zu dürfen. Umsonst, wie sich herausstellt. Eigentlich war alles arrangiert, aber offensichtlich wissen das nicht alle. Die Enttäuschung ist anfänglich groß, man wird die Rollstühle, die der Bezirk Schwaben in Deutschland organisiert hat, aber zu einem anderen Zeitpunkt abholen können.

Wir fahren an den Stadtrand. Dort werden in einer riesigen Halle, die von einer lokalen NGO betrieben wird, Güter verschiedener europäischer Hilfsorganisationen zwischengelagert. Die pralle Sonne scheint auf das Gelände, das auch als Kulisse für einen modernen Western dienen könnte. Ein Wasserturm wirft seinen schlanken Schatten in den Kies. „Strickschal’s Frauen Winter“ oder „Ohne Bommel Herren Strickmütze“ steht auf den Kisten in der Halle. Mitten in der brütenden Hitze wird mir klar: Winter is coming. Für die Ukraine ein großes Problem.
Die Menschen, die sich um die Logistik in der Halle kümmern, sind uns offensichtlich gewogen. Nicht zuletzt, weil Chrystyna perfekt auf Rumänisch kommunizieren kann. Aber vor allem, weil die Notlage der Ukrainer auf großes Verständnis stößt. Die Bedrohung seitens des verhaltensauffälligen Nachbarn im Osten steckt auch vielen Rumänen noch aus „alten Zeiten“ in den Knochen. Ich nehme mir vor, bei jeder sinnvollen Gelegenheit darauf hinzuweisen, wie viel in Rumänien für die ukrainischen Nachbarn geleistet wird. Die Ladefläche füllt sich dann rasch mit Paletten, auf denen sich Windeln für alle Altersklassen und andere Hilfsgüter stapeln.
Richtung Czernowitz
Wir verlassen die Europäische Union. Der Grenzübertritt verläuft ohne Probleme. Ich spähe auf meine Landkarte, die ich vorsorglich auf mein Handy geladen habe, in der Ukraine ist das Roaming teuer. Keine 30 Kilometer westlich von uns liegt Putila, jener Ort, in dem der Lyriker Manfred Winkler geboren wurde, vor ziemlich genau 100 Jahren. Sein Nachlass findet sich im IKGS. Noch im Herbst wird ein sorgfältig edierter Band mit seinen Gedichten erscheinen, die er nach seiner Auswanderung nach Israel sowohl auf Deutsch als auch auf Hebräisch verfasst hat. Putila liegt heute knapp auf der ukrainischen Seite der Grenze.
Die kurze Strecke nach Czernowitz ist gut ausgebaut. Auf der Gegenspur stauen sich die LKWs. Gelegentlich laden Straßenschilder auf Ukrainisch und Englisch ein, die Hauptstraße zu verlassen: um eine Kirche der vor Jahrhunderten aus Russland in die Bukowina geflüchteten sogenannten Altgläubigen zu besichtigen. Oder nach Dymka zu fahren, wo die Schriftstellerin Olha Kobyljanska geboren wurde und wo man ihr ein Museum eingerichtet hat. Als einer von sieben Sprösslingen eines „kleinen“ ukrainischen k. u. k. Beamten und einer deutsch-polnischen Mutter hatte sie früh zu schreiben begonnen: zuerst auf Polnisch, später mit größerer Resonanz auf Deutsch, um dann ins Ukrainische zu wechseln. Heute hat sie den Status einer ukrainischen Nationaldichterin. Sie wird uns noch öfter begegnen.
In der Hauptstadt der Nordbukowina – Kakanisch Czernowitz, Ukrainisch Tscherniwzi – angekommen, fahren wir ins Lager der Universität, um die Hilfsgüter abzuladen. Viele helfende Hände, viel zu routiniert im Hilfsgüterstapeln und -verteilen. Das Lager befindet sich im Hof eines Universitätsgebäudes. Nicht in irgendeinem, sondern im einstigen Hauptgebäude. Sozusagen im universitären Gründungsobjekt. Hier wurde 1875 die Franz-Josephs-Universität inauguriert. In der Mitte des Hofes steht ein prächtiger, ausladender Baum. Wenigstens gibt es Schatten, denke ich mir.

Stadtstreunen
Es wird Abend, Oxana lädt mich noch zum Essen ein. Wir gehen in ein aus Charkiw umgesiedeltes Restaurant, das Lokal ist stylish, das Essen bodenständig, das Personal fast so hilflos wie ich, was wohl an mir liegt, jedenfalls: ausgezeichnete Küche. Irgendwann, erzählt mir Oxana, will man zurück nach Charkiw, in Czernowitz soll eine Filiale bleiben. Finde ich gut. Anschließend streune ich durch die Stadt, die Hügel der Stadt in der Abendsonne. Kaiser Franz Josefs Statue steht in seinem Park, dort bei der katholischen Herz-Jesu Kirche, inmitten einer Baustelle, der Park wird gerade renoviert. Ein Mann, der meinen möglicherweise etwas touristischen Habitus bemerkt hat, erklärt mir etwas auf Ukrainisch, dann auf Russisch. Rumänisch kann er leider nicht.

Wenn man es sich einreden will, ist hier fast alles wie immer. Wieso fühlt man sich hier zuhause, obwohl man definitiv nicht mehr als ein flüchtiger Gast ist? (Freilich einer, der immer wieder kommt.) Nur Kinder fahren neuerdings mit E-Scootern über das holprige Pflaster, und mitten auf dem einstigen Austria-Platz, vis-a-vis des Sowjetdenkmals, stehen Zelte einer italienischen Hilfsorganisation. Auf den Friedhöfen gibt es viele frische Gräber. Am Eingang zur Kobyljanska-Straße, einst die Herrengasse, steht ein junger Mann mit seinem Flügelhorn und trägt beherzt seine Fassung von Frank Sinatras „My Way“ vor. Ich darf in der Wohnung einer Kollegin aus Deutschland übernachten, sie musste das Land zu Kriegsbeginn verlassen.
Beim Rektor und im Luftschutzkeller
Um neun Uhr treffe ich den Rektor der Jurij-Fedkowytsch-Universität Czernowitz, Roman Petryshyn. Oxana steht uns als Übersetzerin bei. Er hat sich Zeit genommen für mich, ist gut vorbereitet. Internationaler Besuch ist mehr als rar im Moment. Obwohl gerade Sommerferien sind, gibt es viel zu tun: ab September will die Universität soweit möglich wieder auf Präsenzbetrieb umstellen. Seit der Pandemie seien die Studierenden online unterrichtet worden, man spüre aber, wie sehr der persönliche Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden fehle. Einige Kommilitonen und Lehrende sind schon an der Front. Die Furcht der anderen, dass es ihnen ebenso geht, ist groß, auch wenn man bereit ist, sein Land zu verteidigen. Was mir Rektor Petryshyn sonst noch erzählt hat, können Sie hier auf Spotify oder unten auf Youtube nachhören.
Wir befinden uns im Hauptgebäude der Universität, dem ehemaligen Sitz des orthodoxen Metropoliten, der einst nicht nur für die Bukowina, sondern auch für Dalmatien zuständig war. Vor 1918 haben die ukrainischen wie die rumänischen Theologen in Czernowitz ihr Studium größtenteils auf Deutsch absolviert. Die Architektur ist wunderschön, UNESCO-Weltkulturerbe, es kann sich mit den schönsten Universitätsgebäuden der Welt messen. Nur dass weder in Oxford noch in Hogwarts ein Schild mit „Schutzraum“ am Eingangstor hängt. Falls Luftalarm gegeben wird, können sich Menschen aus der Umgebung hierher flüchten.
Ich will die Kellerräumlichkeiten sehen, die gerade zu weiteren Luftschutzbunkern ertüchtigt werden. Wände werden verputzt, in manchen Räumen stehen bereits Stühle an den Wänden, Tischtennistische in der Mitte. Prorektorin Tamara Marusyk wird mir später beim Mittagessen erzählen, dass hier die Universitätskantine untergebracht war, als sie studiert hat. Sie soll recht schön gewesen sein, die Kantine. Ohne funktionierende Luftschutzräume kann es keinen Präsenzunterricht geben im Herbst. Wir werden im Rahmen der Bukowinahilfe Unterstützung leisten, damit das möglich wird.
Nachbesprechung mit Oxana im Zentrum Gedankendach, das in der Nähe des Internationalen Büros der Universität untergebracht ist. Der Raum liegt gleich neben jenem des DAAD. Hier haben wir vor rund drei Jahren das zehnjährige Jubiläum des Zentrum Gedankendach gefeiert. Auf einem Schrank thronen kleine Flaggen, die deutsche, die österreichische und die schweizerische, eingerahmt vom Blau-Gelb der Ukraine und den goldenen Sternen der Europäischen Union. Ich kriege guten Espresso und eine Mozartkugel dazu. Auf dem Tisch neben mir befindet sich ein Stapel Kinderbücher auf Ukrainisch. Ich muss weiter.
Im Museum für jüdische Geschichte und Kultur der Bukowina
Um halb elf bin ich mit Mykola Kuschnir verabredet. Er ist der Direktor des Museums für jüdische Geschichte und Kultur der Bukowina. Es befindet sich im „Jüdischen Nationalhaus“, das noch zu Kaisers Zeiten gleich neben dem Theatergebäude errichtet wurde. Der Platz ist einer der schönsten in der Stadt, da stand auch einmal Schiller vor dem Theater, das fast genauso aussieht wie das Stadttheater in Fürth. Das berühmte Architektenbüro Helmer und Fellner hatte den Bau ursprünglich für Czernowitz geplant, dort gab es dann aber kein Geld und so setzte man die Pläne zuerst in der mittelfränkischen Stadt ein und um. Später, 1904/1905, bekam dann Czernowitz doch noch sein „Deutsches Stadttheater“. Es ist heute nach Olha Kobylanska benannt. Ihre monumentale Statue vor dem Gebäude trägt nun einen blau-gelben Umhang. Fast streife ich an ihm an, als ich Richtung Museum spaziere.

Mit Mykola, der sich auch in den internationalen Netzwerken zur Rettung ukrainischen Kulturguts engagiert, führe ich ein langes Gespräch über die Situation in der Stadt, über Politik, Kultur und sein Museum. Ein weitere Innenperspektive. Ein Land, ein Volk im Krieg, zwischen Hoffnung auf den Westen und der Furcht, missverstanden zu werden. Wir reden auch über Nationalismus und Antisemitismus, naheliegend in diesen Mauern. Gemeinsam phantasieren wir von der Zeit, in der eine fokussierte, fachlich und sachlich gestützte Aufarbeitung dieses Teils der ukrainischen – und damit auch zentraleuropäischen – Geschichte möglich sein wird. Die Rastlosigkeit und die Emotion des Krieges verhindern im Moment aber jede Initiative, die den Horizont des aktuell Dringlichen überschreiten vermag, materiell wie ideell.
Stets muss Mykola damit rechnen, zum Militär eingezogen zu werden. Er ist, wenn es sein muss, dazu bereit. Er offenbart mir, dass er aktuell nur mehr ehrenamtlich für das Museum arbeitet, weil die Finanzierung der privaten Geldgeber ausgefallen ist. Wünschenswert wäre, dass sich die lokale Verwaltung stärker bei der Sicherstellung der Gelder einbrächte, was in einer Stadt, die einst von über einem Drittel Juden bewohnt wurde, eine gewisse Logik hätte. Jetzt gibt es aber, aus viel zu nahe liegenden Gründen, ohnehin keine Mittel.
Ich bitte Mykola, mir sein kleines, so gut gepflegtes Museum zu zeigen. Im Rahmen dieser Führung sprechen wir nicht nur über die Geschichte der Juden in der Bukowina, sondern auch über die Sicherungsmaßnahmen, die es in der Kriegssituation braucht. Wenn Sie möchten, können Sie mit uns mitkommen: unser Gespräch mithören (Spotify), und wenn Sie wollen, hier unten auch mitschauen.
Essen bei Rita Steinberg
Mit Vizerektorin Tamara Marusyk darf ich die Mittagszeit im „Rita Steinberg“ verbringen, einem Restaurant im Universitätsviertel, gehobene jüdische Küche, ich kriege eine großartige Kalbszunge und Wein aus Bessarabien. Die Themen kreisen um die Probleme, die eine Universität in Kriegsfall zu bewältigen hat. Schon vorher war es nicht leicht. Aber es ist auch hier bergauf gegangen, langsam. Menschen wie Marusyk wissen, wohin die Reise eigentlich gehen könnte, wenn die Voraussetzungen nur ein wenig anders wären als sie es gerade sind und waren, ante bellum. Kontroverse innenpolitische Debatten gibt es aber im Moment kaum. Jetzt heißt es vor allem: zusammenhalten.
Wir reden darüber, wo wir konkret helfen können, über die Luftschutzkeller. Wie Präsenzunterricht möglich wird, über den kommenden Winter. Marusyk ist für Forschung und Unterricht zuständig, sie weiß, welch großen Stellenwert der persönliche Kontakt im universitären Biotop einnimmt. Zuhause hat sie eine Kollegin aus Saporischschja untergebracht, eigentlich von der Universität in Donezk, sie ist also schon zweimal geflüchtet, wie viele, die jetzt in Czernowitz stranden. Noch hat keine Rakete die Stadt getroffen, alle hoffen, dass das so bleibt, befürchten aber anderes. Die Russen zielen schlecht.
Wir tauschen uns auch fachlich aus, vergessen die Zeit, Marusyk hat ihre Habilitation zu den 1940er-Jahren verfasst, als der Faschismus hier wütete und als die Region sowjetisch wurde. Sie konnte dazu Geheimdienstakten auswerten, kennt Namen, mehr, als sie den Nachfahren von Opfern dieser und jener Regimes zumuten will. Wir sind uns einig: Geheimdienstakten sind Gift, das noch Jahrzehnte nach ihrer Entstehung wirkt. Zum Abschied überreicht mir die Vizerektorin mit ironisch-verschmitztem Lächeln einen Kühlschrankmagneten mit Bildern der Universität.

Manche möchten sich jetzt fragen, wie man in diesen Zeiten, in diesem Land ins Restaurant gehen kann. Ich schließe mich meiner Kollegin Oxana an, die in ihrem Ukrainischen Tagebuch in der Süddeutschen Zeitung schon im März festgestellt hat: „Wie gut, dass Menschen ins Restaurant gehen“. Man kann, man soll, wenn man kann.
Meridian findet Stadt
Ich eile zum nächsten Gespräch, den Universitätshügel hinunter, über den Zentralplatz in die Kobyljanska-Straße, wo das Paul Celan-Literaturzentrum seinen Sitz hat. Dort wartet Evgenia Lopata auf mich. Sie ist die künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin des Lyrikfestivals Meridian Czernowitz sowie des gleichnamigen Verlags. Das Literaturzentrum besteht seit 2013 und wird von Prof. Petro Rychlo geleitet, einem führenden Kopf der Bukowinischen Literaturwissenschaft, Übersetzer von deutschsprachigen Autoren ins Ukrainische. Vor wenigen Wochen durfte ich im Literaturhaus Stuttgart mit ihm ein Gespräch über sein Leib- und Lebensthema, „Czernowitz/Tscherniwzi und die Literaturen der Bukowina“ führen. Man kann es hier nachhören.

Evgenia erzählt mir von den Herausforderungen, vor denen das kleine Team rund um das Literaturzentrum und das Lyrikfestival Meridian steht. Die Miete für das sorgfältig renovierte, für kulturelle Veranstaltungen perfekt adaptierte Veranstaltungslokal soll sich vervielfachen und wäre dann nicht mehr zu finanzieren. Nur die aktuelle Situation lässt darauf hoffen, dass der vertragliche Status quo noch ein wenig erhalten bleibt. Das Zentrum bietet vielen kulturinteressieren Geflüchteten eine Anlaufstelle.
Und dann ist da noch Meridian, das mittlerweile legendäre Lyrikfestival, das die Pandemie in den vergangenen beiden Jahren ins ausschließlich Virtuelle gedrängt hat: dieses Jahr soll es wieder vor Ort stattfinden, freilich auch digital, aber vor allem mit fassbaren Menschen, auch hochkarätigen Gästen aus dem Ausland. Die „Kulturfront“ sei wichtig, meint Evgenia, man müsse gerade jetzt zeigen, welchen Stellenwert Kultur in der Ukraine einnehme. An den Begriff kann ich mich nur schwer gewöhnen, ich glaube aber zu verstehen, was gemeint ist und kann es nachvollziehen. Was mir Evgenia sonst noch über die Besonderheiten der Stadt, ihre Wahrnehmung und die Pläne für Meridian erzählt hat, können Sie hier auf Spotify oder unten auf Youtube hören.
20 Partisanen für eine gute Zeit in Czernowitz
In einem schicken Kaffeehaus am Theaterplatz treffe ich Olha Poliak. Mit ihr solle ich unbedingt sprechen, hatte Oxana gemeint, als ich sie nach interessanten Gesprächspartnern für meine kurze Reise fragte. Olha sei viel zu bescheiden, ihre Kunstprojekte mit und für Jugendlichen in der Stadt enorm wertvoll. Insbesondere jetzt, wo auch noch viele Flüchtlinge im Teenageralter in der Stadt wohnten.
Die Musik ist etwas zu laut hier, aber es gibt richtig guten Kaffee, Fritz-Cola aus Berlin und Kombucha aus der Ukraine. Wir könnten auch in Kreuzberg, Schwabing oder am Spittelberg sitzen, aber das in diesem Moment schade zu finden fiele wohl nur hartgesottenen Oswald Spengler-Aficionados oder Berufsnörglern ein. Was Olha in enger Zusammenarbeit mit dem Zentrum Gedankendach auf die Beine stellt und warum sie das tut, können Sie hier im Interview nachlesen. „Verheimatung“ fällt mir ein, aber der ohnehin verkopfte Begriff passt nicht. Die Jugendlichen wollen ja zurück, in die Heimat, auf die mit Raketen geschossen wird. Manche werden bleiben, andere in den Westen gehen. Ich werde aber das Gefühl nicht los, dass wir auch „bei uns“ viel mehr solche Angebote bräuchten, um jungen Menschen ein Ankommen und sich Zurechtfinden zu ermöglichen. Vor allem, wenn sie selbst die Verantwortung für ihre Projekte, ihr Leben, zu übernehmen lernen.
Die Moldau, der größte gemeinsame historische Nenner
Bevor es wieder Richtung Rumänien geht, trinke ich noch einen schnellen Kaffee mit meiner Kollegin Nataliya Nechayeva-Yuriychuk. Gemeinsam mit ihren Studierenden hat sie mir via Zoom-Meeting schon mehrmals Einblick in den Alltag in Kriegszeiten gegeben. Nun endlich die Gelegenheit, ein paar Worte persönlich auszutauschen. Wir sitzen erneut im Rita Steinberg, auch die Desserts sind ausgezeichnet. Wieder guter Kaffee. Mit Nataliya spreche ich über die Zeit, bevor es die Bukowina als solche gab. Bis zur Eingliederung in das habsburgische Herrschaftssystem war die Landschaft Teil des Fürstentums Moldau. (Ich schreibe Landschaft, denn zur Region mit eigener, starker Identität wurde die Bukowina erst allmählich in der Donaumonarchie.) Das moldauische Erbe wird uns im IKGS in den kommenden Monaten intensiv beschäftigen. Es verbindet Regionen in mehreren Staaten: in der Ukraine, in Rumänien und natürlich in der Republik Moldau. Ein Land, das ebenfalls auf der moskauischen Revisionismus-Liste zu finden ist. Und eine Gesellschaft, sie den Flüchtlingen aus dem Nachbarland wie kein anderes hilft. Auch das wird gerne übersehen – jedoch nicht in der Ukraine, dort ist man seinem kleinen, tapferen und solidarischen Nachbarn dankbar.
Abschied von der Stadt am Pruth
Gegen Abend geht es Richtung Grenze. Oxana begleitet mich. Damit ich sicher hinüberkomme, meint sie. Hinüber heißt, das letzte Stück zu Fuß zu gehen, das ginge am schnellsten. Und tatsächlich: innerhalb kürzester Frist bin ich wieder auf der rumänischen Seite. Abschied von Oxana, bald sehe ich sie und die weiteren Mitstreiter aus dem stetig wachsenden Netzwerk Gedankendach wieder, zumindest online.
Von der Nord- in die Südbukowina, von der Ukraine nach Rumänien zu gelangen, hat nur zwanzig Minuten gedauert. Die Landschaft ist indes dieselbe geblieben. Grüne Mutter / Bukowina, schrieb Rose Ausländer im Düsseldorfer Exil, Viersprachenlieder / Menschen / die sich verstehen. Und doch scheinen heute Welten zwischen den beiden Seiten des Grenzzauns zu liegen. Ich gehöre nicht zu denen, die von einer grenzenlosen Welt träumen. Und doch fragte ich mich, ob es wirklich Sinn macht, eine Region wie die Bukowina mit ihrem so starken regionalen Erbe in zwei Teile zu teilen, langfristig gedacht. Mittelfristig aber ist ein Krieg zu überstehen.
Hinter mir liegt eine viel zu kurzen Reise in jene selbst in diesen brutalen Zeiten so bezaubernde, kleine, große Stadt am Pruth. Sie kann in ihrer mehrfachen Randlage gar nicht anders, als gelegentlich zum Mittelpunkt der Welt zu werden. <>
Florian Kührer-Wielach