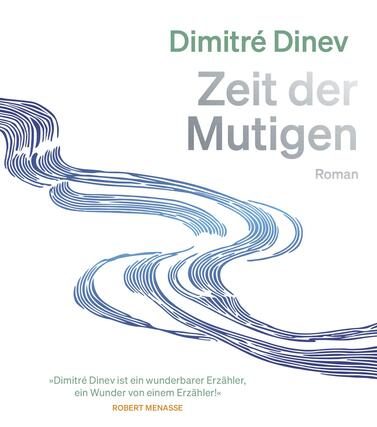Eine Mutter, wie sie hätte sein sollen | Carmen-Francesca Banciu: Mutters Tag | Besprechung
von IKGS München
Mit „Mutters Tag. Das Lied der traurigen Mutter“ legt Carmen-Francesca Banciu den zweiten Teil ihrer Trilogie des Optimisten in überarbeiteter Neuauflage vor. Der Roman erschien erstmals 2007 im Berliner Rothbuch Verlag und bildet das erzählerische Gegenstück zu „Vaterflucht“ (1998). Stand dort die konfliktreiche Auseinandersetzung mit der Vaterfigur im Zentrum, richtet Banciu nun den Blick auf die Mutter – eine Frau, die ihre tiefsten emotionalen Bedürfnisse leugnet, um ein verlässlicher und immer verfügbarer neuer Mensch im Dienste der Gesellschaft zu werden.
20. Oktober 2025Carmen-Francesca Banciu: Mutters Tag. Das Lied der traurigen Mutter. Roman. Berlin: Palm ArtPress 2024. 248 S.
Die Autorin erzählt von einer Kindheit im sozialistischen Rumänien, in der Familienleben und öffentliche Ideologie unauflöslich ineinander verschränkt sind. Das Bild der Mutter erscheint dabei fern jeder Verklärung, in seiner ganzen Widersprüchlichkeit: als Leidtragende und zugleich als Komplizin eines Systems, das bis in die Werte und in die Sprache der Familie hineinwirkt. Bancius Prosa macht sichtbar, wie subtil Macht in den Alltag einsickert – sich in Gesten, in Verboten, in den Formeln einer Sprache zeigt, die zum Erziehungsinstrument und zugleich Herrschaftsmittel wird. Der Roman prangert diese versiffte Sprache an, die zugleich einer pervertierten Pädagogik dient. Alle erziehen alle: Man überwacht, schilt und bestraft. Kinder werden zu den vollkommenen Opfern des kollektiven Umerziehungswahns – im familiären wie im gesellschaftlichen Raum: „Wir wurden überall erzogen. Überall und von jedem. In der Schule wurden wir erzogen. Die Verkäuferin durfte uns erziehen. Der Milchmann. Die Partei“. (S. 33) Sie gelten als das Zukunftsmaterial, das makellos geformt werden muss, als Projektionsfläche einer Perfektion, die keinen Fehler, keine Abweichung duldet. Gerade im Mikrokosmos der Familie zeigt sich das Scheitern der kommunistischen Ideologie am deutlichsten: Je höher die eigenen sowie eingeredeten Erwartungen, desto größer die Bereitschaft, Gewalt als Mittel zu legitimieren. Die Utopie einer perfekten Gesellschaft verkehrt sich in den Alltag einer permanenten Kontrolle – und selbst Gewalt gegen die eigenen Kinder findet in diesem Kontext ihre scheinbare Rechtfertigung.
Der Roman setzt mit der Schilderung des letzten Tages im Leben der Mutter ein, die im Krankenhaus liegt. Diese Szene verbindet sich mit der Erinnerung an die alljährliche, ritualisierte Feier des Muttertags im Kommunismus. Die Tochter bringt der leidenden Mutter zum ersten und letzten Mal Blumen – ein Akt, der unmittelbar an die kindliche Geste anschließt, der Mutter am offiziellen Feiertag ein Zeichen der Zuneigung zu überreichen. Die bewusste Überlagerung zweier Ebenen – zum einen der realen Biografie der Mutter, die von Erbarmungslosigkeit sich selbst wie auch der Tochter gegenüber geprägt ist, zum anderen des ideologisch aufgeladenen Bildes der idealisierten Mutter, wie es das System propagierte – entfaltet nicht nur introspektive und reflexive Kraft, sondern gewinnt auch einen ironischen Unterton. Der Vergleich der sterbenden Mutter mit der Vorstellung einer besseren, idealen Mutter, einer Mutter, wie sie hätte sein sollen, findet unausweichlich statt, ist jedoch von vornherein problematisch. Denn in jenem Idealbild ist die Mutter ebenso abwesend wie bei den schulischen Feierlichkeiten, die zu ihrer Ehre abgehalten wurden, in Wahrheit aber in ihrer Abwesenheit stattfanden – während die Mütter selbst an ihren Arbeitsplätzen blieben und nichts von den Lobreden und Gesten erfuhren, die offiziell ihnen galten. Die Blumen, die den Müttern als Zeichen kindlicher Dankbarkeit galten, nahm stellvertretend die Klassenlehrerin entgegen. So drängt sich eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung auf: Ist es moralisch vertretbar, die Mutter an einem Idealmaßstab zu messen, der von außen auferlegt, ideologisch überhöht und zugleich von der Tochter selbst verinnerlicht und weiterentwickelt worden ist? Die Tochter hat die Aufgabe, die Mutter im Kontext ihrer eigenen Biografie zu begreifen, sie vielleicht hier und da sogar zu entschuldigen oder ihr zu verzeihen – und dies, ohne sich selbst dabei zu verleugnen. Die Rekonstruktion der verhassten Elternwelt muss zugleich Heilung verschaffen. Mutters Tag ist ein Roman von schwieriger Anlage, der einen schonungslosen Blick in die Psyche des traumatisierten Kindes wirft – und ebenso in jene der ideologisch radikalisierten Erwachsenen. Es ist zugleich ein Gesellschafts- und ein Dokumentarroman, der, um Glaubwürdigkeit und Allgemeingültigkeit zu sichern, mit Bedacht verschiedene erzählerische Vorkehrungen trifft. Die Vorwürfe an die Mutter sind stets von Erklärungen begleitet: eine Kette körperlicher und symbolischer Strafen, von Verboten und einer Obsession der Kontrolle, die aus einer überprotektiven, zugleich aber überfordernden Liebe entspringt. Das Kind soll vor Bindungen bewahrt, vor Schwächen geschützt werden; es soll lernen, nur auf sich selbst zu vertrauen, Leistung zu erbringen und sich zu behaupten. So erscheint es der Mutter etwa folgerichtig, am ersten Schultag der Tochter deren sämtliche Puppen zu verbrennen. Die Mutter agiert in einer Logik der permanenten Revolution: Kein Opfer ist zu groß, keines je ausreichend, und für Dank gibt es keinen Raum. Sie erteilt nur Befehle, dankt nicht, lobt nicht. Freude wie Belohnung sind untersagt. In der häuslichen Welt des Spätstalinismus fehlt jede Spur von Güte, Dankbarkeit, Vergebung, von Liebe. Am Ende ihres Lebens fordert die Mutter die Tochter auf, für sie zu beten – ohne ihr dies je beigebracht zu haben. Ihre moralischen Lektionen sind zerreißend, widersprüchlich, unpraktikabel, trügerisch. Besonders eindringlich erscheint das moralische Porträt der Mutter in ihrer Neigung zu abstrakten Ersatzthemen: zum Weltfrieden statt zum häuslichen Frieden, zum Kollektivwohl statt zum Wohl des eigenen Kindes. Ein starkes Bild zeichnet sie als Wesen, das zu viel Luft geschluckt hat und nur noch flach atmen kann. Die Mutter-Propagandistin wird zu einer künstlich aufgeblähten, innerlich hohlen Gestalt – ohne Lebenskraft.
Nicht nur die tiefe Verinnerlichung ideologischer Anforderungen erschöpft die Mutter. Auch ihre frühere Erziehung im Pensionat unter Leitung von Nonnen hatte ihr nicht die Tugenden von Barmherzigkeit und Liebe eingeprägt, und selbst die patriarchalische Gesellschaft – die im Kommunismus nicht nur fortbesteht, sondern in ihrer Unterdrückung der Frau sogar gestärkt wird – lässt ihr keinen Raum, sich anders zu entfalten. Die Relativierung der Anklage gegen die Mutter gelingt auch durch Rückblicke in die Familiengeschichte und die Rekonstruktion sozialer Kontexte.
Aus der Perspektive der Tochter erscheint die Schuld der Mutter erdrückend – ebenso wie die eigene Schuld, sie außerhalb jener Welt zu beurteilen, die sie zu einem unechten, falschen Leben verurteilt hat. Doch ohne diesen schmerzhaften, vielleicht nie ganz klaren Rückblick wäre das Verhältnis der misshandelten Tochter zu sich selbst und zu ihrer eigenen Tochter gefährdet, bedroht von einer Wiederholung der Muster. Die Relativierung des Vorwurfs geschieht bereits aus der Perspektive der Opferfigur, zugleich aber auch aus der übergeordneten Sicht der zentralen Erzählung.
Eine Schlüsselfrage für jede Erzählung lautet: Wer sieht, wer erzählt im Text? Bancius Roman konstruiert zwei erzählerische Instanzen. Einerseits handelt es sich um die Lebensgeschichte der Tochter, die von einer politisch radikalisierten Mutter misshandelt wurde, erzählt aus ihrer eigenen Perspektive. Diese Erzählerin – zugleich Figur des Romans – trägt einen doppelt gesetzten Namen, Maria-Maria, was erneut die innere Zerrissenheit der narrativen Stimme verdeutlicht. Diese Stimme existiert gleichzeitig im Hier und Jetzt der Erzählung wie im Damals und Dort der berichteten Ereignisse und wird von widersprüchlichen Impulsen zerrieben: Verurteilung und Mitgefühl, Ablehnung und Verständnis, Hass, Empörung und dem Bedürfnis nach Liebe.
Andererseits wird diese Erzählerin, die trotz aller Versuche der Kontextualisierung und Objektivierung nur subjektiv sein kann, durch eine zweite, scheinbar unbeteiligte Erzählstimme vermittelt. Diese zweite Erzählerin ist eine Frau, die in einem Café in Berlin sitzt, dort auf die erste Erzählerin trifft und ihr zuhört. Ihre Perspektive, in der dritten Person formuliert, ordnet die Erzählung neu und gibt der Zeugenperspektive in den erinnerten Szenen Präsenz. So wird etwa in der dritten Person aus der übergeordneten Sicht die erwachsene Tochter neben der kranken Mutter mit Mitgefühl als das verletzte Kind gesehen, das niemals aufgehört hat zu leiden: „Maria-Maria ist ein Kind mit einem übergroßen Strauß am Bett der Mutter“. (S. 20)
Diese Verdopplung der erzählerischen Stimmen ist weniger realistisch als symbolisch zu verstehen. Neben der Zeugenfigur, die noch von ihren Erfahrungen geprägt ist, steht eine distanzierte Figur aus einer späteren Lebensphase, die das traumatische Ereignis überwunden hat und die Zeugenschaft der ersten mit Verständnis, mit Empathie, aber ohne eigenes Leiden aufnehmen kann. Bancius Roman ist zugleich ein therapeutisches Werk, das narrativ die Etappen der Selbstwiederherstellung nach einer schmerzhaften, aber notwendigen Anamnese nachzeichnet: die Überwindung von Hilflosigkeit und diffusen Schuldgefühlen, die Reflexion über erlittene Traumata und die allmähliche Rückgewinnung von Selbstachtung. Dabei wird sichtbar, wie Erinnerung, Erzählung, Projektion und Fiktionalisierung zu Mitteln der Heilung werden, die es ermöglichen, Vergangenes zu ordnen, zu verstehen und schließlich in die eigene Lebensgeschichte zu integrieren.
All diese Etappen spiegeln sich auch stilistisch wider, durch eine Abfolge parataktischer Sätze, die ohne kausale oder konjunktive Verbindungen auskommen und so die Sprache der Wut nachzeichnen, die sich nur mühsam zu analytischem Ausdruck aufschwingt. Dieses stockende Sprechen, geprägt von Pausen, Wiederholungen, Umformulierungen, Steigerungen, aber auch von Ironie, entwickelt sich stellenweise zu einer beinahe poetischen Sprache, zu einer Litanei von kathartischer Wirkung. Carmen-Francesca Banciu verfügt über lange Erfahrung mit diesem fragmentierten Stil, aufgelöst in kurze, elliptische Sätze, in denen die einzelnen Elemente der Phrase zerlegt und kinetisch immer wieder neu arrangiert werden – härter, percussiver, und zwar bereits vom ersten literarischen Werk an, dem auf Rumänisch erschienenen Erzählband Manualul de întrebări [Lehrbuch für Fragen, Bukarest: Cartea Românească 1984]. Dieser Stil ist zu einem unverwechselbaren Markenzeichen der Autorin geworden, das seine volle Rechtfertigung auch im vorliegenden Roman findet.
Zur Entstehung dieses Bandes haben auch die Töchter der Autorin beigetragen: Marijuana Gheorghiu übernahm die Illustration und das Cover-Design, während Meda Gheorghiu-Banciu mit den grafischen Arbeiten im Buch selbst Akzente setzte. Leider wurde bei der Wiedergabe der rumänischen Wörter das diakritische Zeichen für den rumänischen Vokal ă (Schwa [ə] im Internationalen Phonetischen Alphabet) typografisch nicht korrekt umgesetzt und mit dem Zirkumflex über dem Vokal â verwechselt, was bedauerlich ist.
Romanița Constantinescu