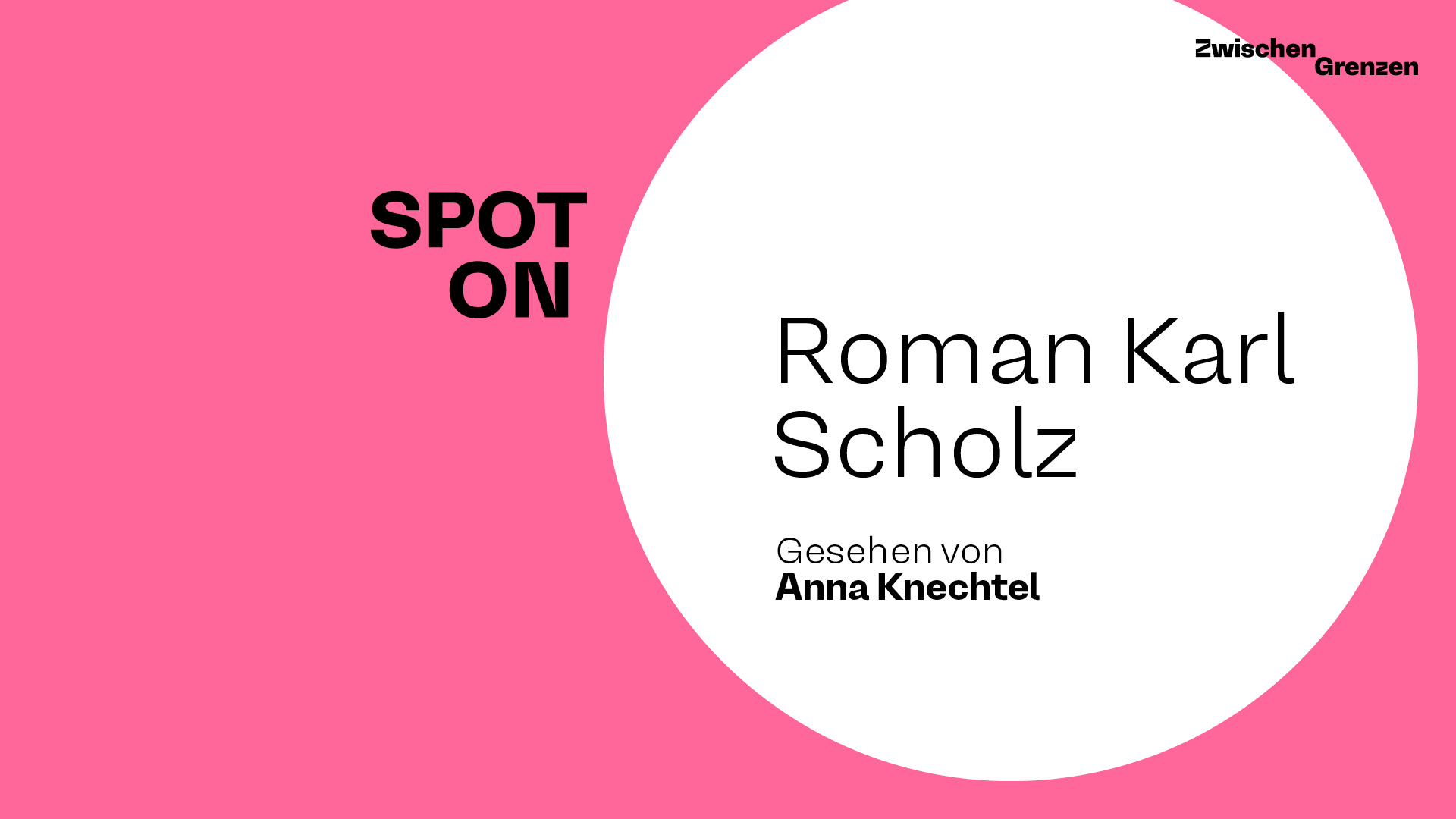Grenzen und Grenzüberschreitungen in der Dobrudscha
Konfessionen oder Religionen?
von Tobias Weger
Die Dobrudscha ist eine europäische Grenzregion zwischen Donau und Schwarzem Meer. Menschen unterschiedlicher ethnischer und religiöser Zugehörigkeit leben dort zusammen. Wie wirkt sich diese multikulturelle Vielfalt im Alltag aus? Wie war dies in früheren Jahrzehnten?
19. Oktober 2022
6 Uhr morgens – über den unendlichen Wasser-Weiten des Schwarzen Meeres geht die Sonne wie ein roter Feuerball auf. Ich betrachte sie vom Balkon unseres Hotelzimmers in Mangalia, einem Badeort etwa 30 Kilometer südlich von Constanța. Am Sandstrand sind bisher nur zwei unentwegte Frühschwimmer zu sehen, ansonsten gehört das Meer noch den Möwen und Kormoranen.
Vom Minarett der nur etwa 500 Meter entfernt gelegenen Esmahan-Sultan-Moschee ruft der Muezzin die muslimischen Gläubigen zum Gebet. Wir befinden uns im nordöstlichsten Abschnitt des bis 1878 zum Osmanischen Reich gehörenden Teils der Balkanhalbinsel. Die Moschee entstand im ausgehenden 16. Jahrhundert. Alte Grabsteine mit kalligrafischen Inschriften, zum Teil von steinernen Turbanen bekrönt, umgeben sie.
Nach wenigen Minuten enden die lautsprecherverstärkten Rufe des Muezzins. Als würde ein Echo diese Rufe verwandelt zurücktragen, beginnen alsbald die Glocken der örtlichen rumänisch-orthodoxen Kirche zu läuten. Die nördliche Dobrudscha gehört seit 1878 zu Rumänien. Mehrheitlich leben hier orthodoxe Christen. Ich bin weder muslimisch noch orthodox. Dennoch kann ich mich dem Zauber dieses Tagesanfangs mit Sonnenaufgang, Gebetsrufen und Glockengeläute nicht entziehen. An diesem Tag beschließe ich, mich mit der Geschichte und Kultur dieser Region gründlicher zu befassen.


Eine Lektion in religiöser Toleranz
Zwei Jahre später. Wir befinden uns auf dem Weg ins Donaudelta. In Tulcea, der letzten großen Stadt, machen wir noch ein paar Besorgungen für die nächsten Tage und besichtigen die dortige Azizye-Moschee. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist geräumiger als die Moschee in Mangalia. Angesichts der feucht-heißen Luft an diesem frühen Nachmittag tut die Abkühlung in der Moschee gut.
Der örtliche Imam betritt das Gotteshaus und wird der Touristengruppe gewahr, die sich im Eingangsbereich ihrer Schuhe entledigt hat. Nach unserer Gewohnheit, keinen Gebetsort zu besichtigen, während dort religiöse Handlungen vollzogen werden, wollen wir gerade wieder kehrt machen. Der Imam spricht uns in perfektem Englisch an: Ob wir nicht Interesse hätten, ein muslimisches Gebet mitzuerleben? Es würde etwa zehn Minuten dauern, wir könnten auf einer der Bänke Platz nehmen und ihm im Anschluss Fragen stellen.
Ich kann mir eine Frage nicht verkneifen: Wie funktioniert eigentlich im Alltag das Zusammenleben von Muslimen und Christen in Tulcea, einer Stadt, in der diese große Moschee und zahlreiche Kirchen so eng beieinanderstehen? Der Imam, inzwischen wieder in seinem zivilen Gewand, schmunzelt bei dieser Frage. Wissen Sie, antwortet er, ich bin selbst mit einer orthodoxen Rumänin verheiratet. In unserem Bücherregal stehen die beiden heiligen Bücher, der Koran und die Bibel, nebeneinander. Jeden Tag lesen meine Frau und ich einander aus diesen Schriften vor…


Wechselseitiger Respekt in früheren Zeiten
Bereits früher sind Menschen christlicher und muslimischer Religion in der Dobrudscha gut miteinander ausgekommen. Deutsche, die dort bis zur nationalsozialistischen „Umsiedlung“ 1940 zu Hause waren, haben vielfach davon berichtet. Feierten sie Weihnachten, kamen ihre türkischen und tatarischen Nachbarn und brachten ihnen Baklava und andere Leckereien vorbei. Die Deutschen revanchierten sich mit Backwaren am Ende des Ramadans, wenn die Muslime das Zuckerfest zum Zeichen des Fastenbrechens begingen. Man wusste von den Unterschieden, betrachtete sie aber im Alltag nicht als unüberwindbare Grenze und respektierte einander.
Ein deutscher Baptistenpastor in Mangalia pflegte Freundschaft mit dem örtlichen Imam. Auf einer Fotografie aus der Zwischenkriegszeit sieht man den Pastor inmitten der Führungsgruppe der örtlichen Moscheegemeinschaft. Kein Zweifel: Hier wurde interreligiöser Dialog gepflegt.
Für den Baptistenpastor war es möglicherweise sogar leichter, sich mit einem türkischen oder tatarischen Nachbarn zu unterhalten als mit einem deutschen evangelisch-lutherischen Berufskollegen. Die Evangelische Kirche A. B. diffamierte ihn als Vertreter einer Freikirche öffentlich in ihren Verlautbarungen als „Sektierer“ oder „Abweichler“. Grenzen zwischen den rivalisierenden christlichen Konfessionen waren gelegentlich undurchlässiger als Grenzen zwischen unterschiedlichen Religionen.


Ein Schulgebet in Cobadin
In der rumänischen Volksschule des Dorfes Cobadin, in dem Tataren, Rumänen und Deutsche zusammenlebten, pflegten die Schüler morgens ein feststehendes Gebet aufzusagen, in dem sie um Gottes Beistand baten. Eines Tages, irgendwann in den 1930er Jahren, kam ein junger Tatare an die Reihe. Er hatte das Gebet bereits mehrmals von seinen rumänischen und deutschen Mitschülern gehört und kannte den Text längst auswendig. Als er sich nach Schulschluss zu Hause seiner Vorbeter-Rolle rühmte, waren seine Eltern nicht angetan: ein christliches Gebet? In der Not wurde der örtliche Hodscha aufgesucht. Der ließ sich von dem Jungen den Text noch einmal aufsagen und befand dann: Bei diesem Text gibt es keinen Widerspruch zu den muslimischen Glaubensgrundsätzen!
Türken und Tataren konnten aufgrund eines bilateralen Abkommens ab 1934 aus der rumänischen Dobrudscha in die Türkei auswandern. Ein Deutscher aus dem bereits erwähnten Dorf Cobadin erinnerte sich, als er in den 1950er Jahren längst in der Bundesrepublik Deutschland zu Hause war, an einen Jugendfreund, der damals mit seiner Familie nach Anatolien gezogen war. Er wandte sich per Brief an die Botschaft in Ankara und traf auf einen hilfsbereiten deutschen Diplomaten. Aufgrund der Angaben konnte der tatsächlich den türkischen Dobrudschaner in Anatolien ausfindig machen.
Die einstigen Spielkameraden begannen eine Korrespondenz, bis eines Tages der Deutsche ein Flugzeug nach Ankara bestieg und sich die beiden inzwischen erwachsenen Männer nach über zwanzig Jahren wieder begegneten. Die gemeinsame Herkunft, das gemeinsame Heimatdorf war offensichtlich verbindender als ethnische, nationale oder religiöse Grenzen.


Culelia war einmal ein typisches Straßendorf, in einer Talsenke in der dobrudschanischen Steppe. Hier lebten vor allem deutsche Bauern, ohne Ausnahme römisch-katholisch. Nachdem sie 1940 fortgegangen waren, kamen rumänische und aromunische Bauern in ihre Häuser. Sie hatten ihrerseits aus der gerade wieder an Bulgarien gefallenen Süddobrudscha fortziehen müssen. Lange hielten sie es nicht aus in der kargen Landschaft.
Culelia – von der Dorfkirche zur Klosterkirche
Culelia verfiel, und in den 1960er Jahren kamen Bulldozer und machten das Dorf dem Erdboden gleich. „Land-Systematisierung“ – mit diesem Wort beschönigten die rumänischen Kommunisten die Zerstörung. Nur die in den frühen 1930er Jahren fertiggestellte, massiv gebaute katholische Kirche blieb verschont. Da sie aber nicht mehr benutzt wurde, stürzte irgendwann ihr Dach ein. Wie ein hohler Zahn ragten ihre Außenmauern in den Himmel.
2005 besuchten orthodoxe Nonnen aus Constanța diese Gegend und waren von der Örtlichkeit angetan. Sie gründeten ein Kloster und bauten die Kirche wieder auf – innen mit Ikonostase und bunten Wandmalereien im „byzantinischen Stil“.
Eine staubige Straße führt heute zu dem Klosterort.
Als ich dort mein Auto abstelle, kommt eine der Nonnen auf mich zu. Was mich an diesen Ort verschlagen habe? Ich erkläre ihr mein Forschungsanliegen. Sie führt mich durch die Kirche, den Klostergarten und schließlich in den kleinen Devotionalienladen im Eingangsbereich des Klosters. An den Wänden hängen vergrößerte Fotografien aus unterschiedlichen Zeiten:
- die katholische Pfarrkirche, inmitten des lebendigen Dorfes;
- die einsame Ruine, zeitweilig als Viehstall genutzt;
- schließlich die mit neuem Leben erfüllte Kirche in ihrer heutigen Funktion.
Ich erfahre, dass früher gelegentlich Nachfahren einstiger Bewohner hierherkamen. Auch hier: keine Grenzen, sondern Respekt für die Menschen, die ursprünglich einmal die Kirche erbaut haben, auch wenn sie keine orthodoxen Christen waren.


Unterschiedliche Zugehörigkeiten
Kollektivbezeichnungen liegen mir nicht. Daher verwende ich auch in meinen Studien nicht den Begriff „Dobrudschadeutsche“, sondern spreche lieber von „Deutschen in der Dobrudscha“. Einen deutschen Lutheraner aus Atmagea, einen deutschen Katholiken aus Malcoci, einen deutschen Baptisten aus Cataloi und einen deutschen Adventisten aus Sarighiol verband in den 1930er Jahren herzlich wenig miteinander.
Historisch lässt sich das auch gut erklären: Die deutschen Diaspora-Protestanten an der unteren Donau unterstanden seit den 1850er Jahren dem preußischen Oberkirchenrat in Berlin und der deutsche Gustav-Adolf-Verein förderte sie finanziell. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Verbindung nach Berlin gekappt, und die Lutheraner in der Dobrudscha schlossen sich der Evangelischen Kirche A. B. in Siebenbürgen an.
In beiden Fällen stimmten also religiöse und ethnische Zugehörigkeit überein: Wer in der Dobrudscha lutherisch war, war automatisch deutsch. Die kirchlichen Autoritäten waren aber in beiden Fällen sehr weit, entweder in Berlin oder in Hermannstadt. Das führte dazu, dass Missionare im 19. Jahrhundert enttäuschte Protestanten für Freikirchen begeistern konnten. Etwa zehn Prozent der Deutschen in der Dobrudscha wurden vor dem Ersten Weltkrieg Baptisten oder Adventisten. Die lutherische Kirche bekriegte sie mit allen publizistischen Mitteln, aus Angst, ihr könnten langfristig alle Schäfchen entweichen…
Bei den deutschen Katholiken war es etwas komplizierter: Sie gehörten zunächst zur Diözese Nicopolis, ab 1883 zum Erzbistum Bukarest. In dieser kirchlichen Struktur waren sie nur eine ethnische Gruppe unter vielen. Erzbischöfe waren Italiener, Deutsche, Schweizer und Rumänen… Der katholischen Gemeinde von Sulina, wo der Sulina-Arm der Donaumündung auf das Schwarze Meer trifft, gehörten Menschen aus über zwanzig Nationen an. In Constanța verhielt es sich nicht anders. Auch in den vor 1940 überwiegend von deutschen Katholiken bewohnten Orten – Malcoci, Caramurat, Culelia oder Ali-Anife – war das Bewusstsein verbreitet, einer übernationalen Kirche anzugehören.
Als 1940 die Nazi-Beamten aus Deutschland in die Dobrudscha kamen, um die Menschen zur „Umsiedlung“ zu motivieren, stießen sie in den katholischen Dörfern auf viel größere Skepsis als in den evangelischen.


Nicht als Lernort überfrachten
Sollte man angesichts so vieler historischer und aktueller Beispiele für religiöse Toleranz nicht die Dobrudscha als eine Art „Lernort“ bekannter machen? Gott bewahre! Was in der Schwarzmeer-Anrainerregion beobachtet werden kann, beruht auf komplexen sozialen Dynamiken, die nicht einfach eins zu eins auf andere Gegenden der Welt übertragbar sind.
Wenn sich erst einmal Kohorten von Weltverstehern in diese Region aufmachen und ihre wissenschaftliche Maschinerie mit Beobachtungen und Befragungen in Gang setzen, wird dieses System entzaubert, wird künstlich und verkümmert schließlich zu einer Art „Freilichtmuseum“.
Lesetipps/Literatur:
Weitere Beiträge zu diesen Themen
Spot on Roman Karl Scholz
Eszter Stricker: In mehreren Ländern und Sprachen...
Spot on Maria Stona
weitere Themen