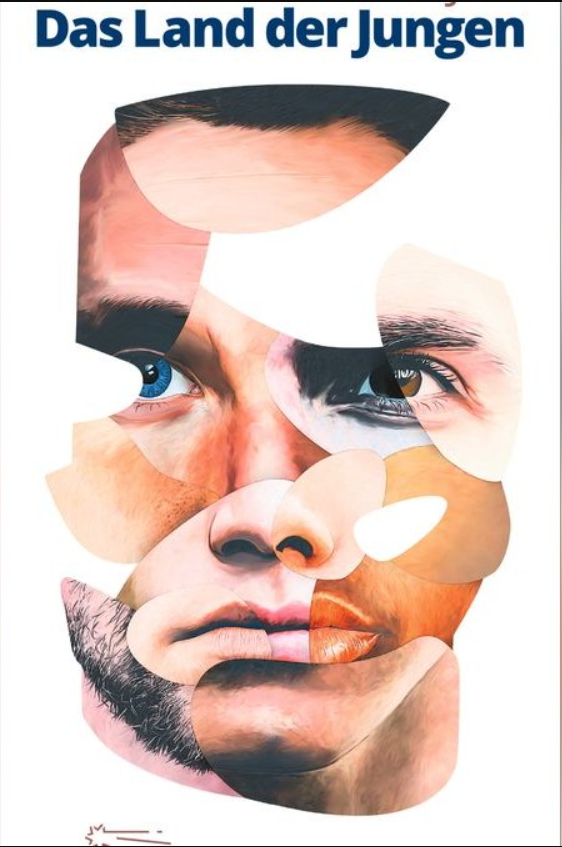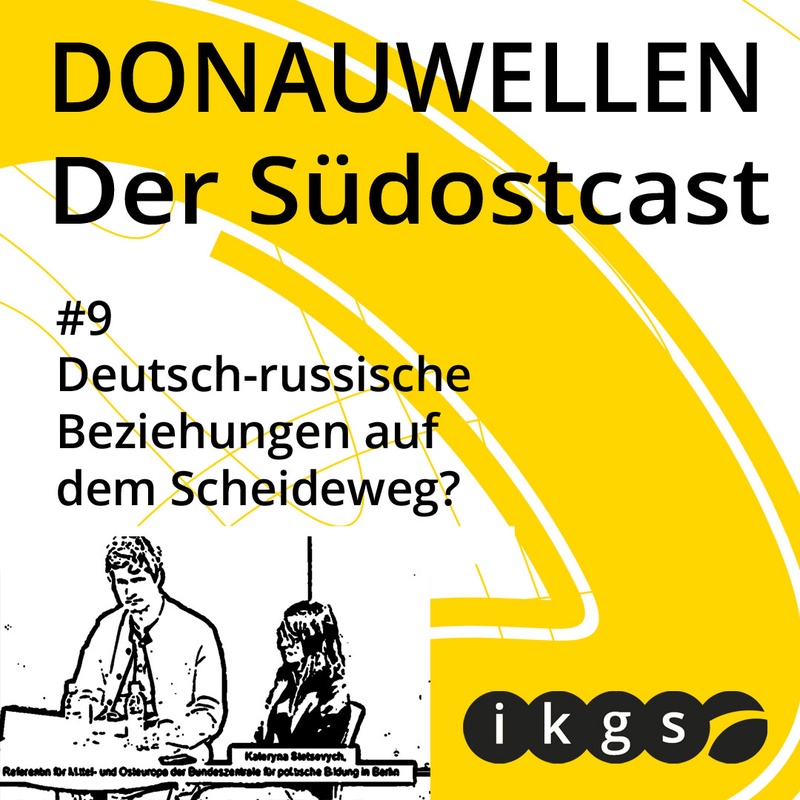Larisa Cercel im Gespräch mit Ernest Wichner
von IKGS München
„Das Übersetzen rumänischer Texte aktiviert so etwas wie eine alternative Existenzweise in mir“
2. September 2025Ernest Wichner ist der Johann-Heinrich-Voß-Preisträger 2020. Der Preis wird seit 1958 von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung „für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Übersetzung“ verliehen. Ausgezeichnet wurde Wichner „für seine einzigartigen Verdienste um die rumänische Literatur“. [1] 2025 erhielt er den Hieronymusring. Dieser wurde 1979 vom VdÜ gestiftet und wird alle zwei Jahre weitergereicht. Damit wird Ernest Wichner für seine Übertragungen rumänischer Prosa und Lyrik gewürdigt.
Der Preisträger ist ein Übersetzer mit Profil und mit einem umfangreichen translatorischen Œuvre. Zahlreiche zeitgenössische rumänische Autoren wie Ana Blandiana, Gellu Naum, Dumitru Țepeneag, Daniel Bănulescu, Nora Iuga, M. Blecher, Norman Manea, Cătălin Mihuleac, Liliana Corobca, Natalia Țibuleac, Varujan Vosganian und nicht zuletzt Mircea Cărtărescu haben durch seine übersetzerische Vermittlung Zugang zum deutschen Publikum gefunden. Es zeichnet Wichner aus, dass er die Autoren nicht nur übersetzt, sondern auch über Jahrzehnte begleitet, um sie in der deutschsprachigen Literatur zu verankern. Dies gilt auch für Mircea Cărtărescu, dessen Werke Wichner seit geraumer Zeit übersetzt (Warum wir die Frauen lieben, Suhrkamp, 2008, Travestie, Suhrkamp, 2010, Die schönen Fremden, Zsolnay, 2016, Solenoid, Zsolnay, 2019, Melancolia, 2022, Theodoros, 2024) und in der deutschen literarischen Öffentlichkeit fördert.
Wichner ist ebenfalls Autor, Literaturkritiker und Herausgeber. Sein erster Gedichtband Steinsuppe erschien 1988 bei Suhrkamp. Es folgten der Prosaband Alte Bilder sowie weitere Gedichtbände: Die Einzahl der Wolken, Rückseite der Gesten, bin ganz wie aufgesperrt, Neuschnee und Ovomaltine, Heute Mai und morgen du – Ausgewählte Gedichte. Er erarbeitete Anthologien zur neueren rumäniendeutschen (Das Wohnen ist kein Ort: Texte & Zeichen aus Siebenbürgen, dem Banat – und den Gegenden versuchter Ankunft, 1987) und zur rumänischen Literatur (Die halluzinogene Katze – Träume, Realien, Stimmen & Stimmengewirr aus der Gegenwart Rumäniens, 2009, Die Entführung aus dem Serail – Rumänische Erzählungen aus dem letzten Jahrzehnt, 2018). In Zusammenarbeit mit Herbert Wiesner gab er zahlreiche Kataloge heraus, die als Begleitbücher zu von ihnen veranstalteten literarischen Ausstellungen im Literaturhaus Berlin entstanden. Ernest Wichner und Herta Müller begleiteten 2004 Oskar Pastior auf einer Reise in die Ukraine an jene Lagerorte, wohin Pastior zwischen 1945 und 1949 als rumäniendeutscher Zwangsarbeiter verschleppt worden war. Müller verdichtete Pastiors Erinnerungen in ihrem Roman Atemschaukel. Wichner betreut seit 2003 die Ausgabe der Werke von Oskar Pastior im Carl Hanser Verlag.
Ernest Wichner, 1952 in Rumänien geboren, studierte in Temeswar (rum. Timișoara, ung. Temesvár) Germanistik und Rumänistik. 1975 wanderte er – als erstes Mitglied der Aktionsgruppe Banat, der er seit ihrer Gründung 1972 angehörte – in die Bundesrepublik Deutschland aus. Wichner setzte in West-Berlin sein Studium der Germanistik und Politologie fort. Er war von 1988 bis 2003 stellvertretender Leiter des Literaturhauses Berlin und von 2003 bis 2017 dessen Leiter. In dieser Funktion hat er zahlreiche Lesungen internationaler Gegenwartsautoren, oft auch von Schriftstellern aus Südosteuropa organisiert und moderiert.
Larisa Cercel: Herr Wichner, in Solenoid hat Mircea Cărtărescu wieder ein überwältigendes Zeugnis seiner schöpferischen Fantasie und seiner Sprachkunst abgelegt – und doch scheint er in dieses Buch noch viel mehr als in die Vorgängerbücher hineingepackt zu haben. Sie sind nicht nur Übersetzer, sondern auch Schriftsteller und Literaturkritiker. Wenn Sie dieses Werk von einer literarischen beziehungsweise literaturkritischen Warte aus betrachten, wie würden Sie es charakterisieren?
Ernest Wichner: Es stimmt schon, ich habe selber Gedichtbände und Erzählungen sowie Literaturkritik veröffentlicht, wenn ich aber ein Buch übersetze, bin ich in Teilen auch Autor dieses Buches und möglicherweise in meinem Urteilsvermögen darüber beschränkter als der Autor selbst. Ich muss schließlich, um übersetzen zu können, erst einmal sprachlich und gedanklich einholen, was da auf dem Blatt steht, und das ist noch lange nicht das, was im Kopf des Autors vorgegangen sein mag. Und es versetzt mich erst recht nicht in die Lage, das von dem Autor Gedachte oder Gewünschte irgendwie distanziert betrachten oder gar beurteilen zu können. An solch einer Stelle findet eine andere Art von Urteil statt: Glaube ich den Text verstehen zu können? Ist er mir gemäß, das heißt nicht so fremd, dass ich ihn mir erst analytisch erschließen muss oder – was noch schlimmer ist – dass ich mich auf eine Melodie und einen Rhythmus und ein Denken einlassen muss, die mir allesamt fremd oder gar entgegenstehend sind? Werde ich mit dem Text über die Dauer der Arbeit daran kohabitieren können? Werde ich mich an diesem Projekt als kreativ mitwirkend beteiligen können oder nur dienend? Das sind einige der Fragen und Problemstellungen, mit denen ich es zu tun habe, wenn ich darüber nachdenke, mich auf die Übersetzung eines größeren Textes einzulassen. Und wenn sie so beantwortet sind, dass ich mich dafür entscheide, beginnt ein sehr kompliziert zu beschreibendes hybrides Zusammenleben zwischen dem Autor, seinem Text und mir als Übersetzer – wobei alle drei Instanzen ihre eigene Souveränität behalten und abgeben und behalten und abgeben … Was will ich Ihnen damit sagen? Vielleicht, dass ich mich nicht in der Lage sehe, Mircea Cărtărescus Buch Solenoid als Literaturkritiker zu beurteilen. Die Gründe dafür sind trivial, also erzählenswert. Bei einem so arbeitsamen wie andauernden Zusammenleben mit einem anderen Geist, der sich auch noch in einer anderen Sprache artikuliert, die einem hin und wieder einige harte Nüsse auf den Tisch rollen lässt, kommt es immer mal wieder vor, dass man in Konflikt mit der Originalstimme gerät. Dass man überzeugt ist, es bedürfe dieses weiteren Schnörkels im Erzählverlauf nicht, der einen jetzt die nächsten zehn Seiten quälen wird. Man selbst, als distanzierter und reflektierter Kritiker würde hier sofort einschreiten: „Was hat sich denn das Lektorat hier gedacht? Oder gab es mal wieder keines, weil Mircea Cărtărescu so bedeutend für die rumänische Literatur ist, dass man seinen Sätzen keine Aufmerksamkeit mehr schenken muss?“ Das geht einem durch den Kopf, aber die folgenden zehn Seiten müssen übersetzt werden. Und dann flucht man still und heimlich und übersetzt die nächsten zehn Seiten. Und wie verhalten sich nun Kritiker und Autor und Übersetzer – alle drei in mir selbst – zu solch einem Vorgang? Mal entscheidet sich der Kritiker, sein kritisches Handwerk vorerst mal wegzupacken, dann sagt der Autor, er könne sich ja darauf herausreden, dass er viel unbedeutender sei als der Autor dieses Romans und infolgedessen einfach die Klappe zu halten habe, und der Übersetzer erfüllt seinen Vertrag. Und so geht alles weiter. Ich könnte Ihnen nun noch eine ganze Weile beschreiben, was zwischen den einzelnen Personae des literarischen Gewerbes so alles hin und her geht, aber es würde zu keinerlei Aufklärung führen. Oder doch. Aber dafür müsste man ewig lange beschreiben und erzählen und abschweifen. Analytisch jedenfalls ist dieser Sache nur beizukommen, wenn man jenseits der Literaturwissenschaft noch allerhand andere Disziplinen hinzuzieht – Verhaltensforschung, sehr viel in mehrere Richtungen auszustreckende Psychologie, vergleichende Kulturforschung bis hin zu einer seriösen Politologie der südosteuropäischen Länder in den letzten dreißig Jahren.
LC: Sie haben sich der Herausforderung gestellt, einen stilistisch wie inhaltlich hochanspruchsvollen, fast 1000 Seiten langen Text, der durch seine ungewöhnliche Sprach- und Bildmächtigkeit selbst rumänische Muttersprachler auf die Probe stellt, zu übersetzen. Ein Dreivierteljahr lang haben Sie einen intensiven Dialog mit Mircea Cărtărescu geführt und auf engstem Raum mit seinem Buch kohabitiert. Es müssen starke Affinitäten, tiefe Verbindungen zum Autor und Buch am Werk gewesen sein, wenn Sie sich auf diese Aufgabe eingelassen haben. Was genau hat Sie dermaßen angesprochen, um trotz evidenter Schwierigkeiten jener fremden Melodie, jenem fremden Denken übersetzerisch zu folgen? Würde der Terminus „Geistesverwandtschaft” Ihre Beziehung zu Mircea Cărtărescus Solenoid adäquat und hinreichend beschreiben?
EW: „Geistesverwandtschaft“ ist vielleicht ein zu großes und damit für meinen Geschmack zu unkonturiertes Wort. Damit kann man ein Verhältnis benennen und anschließend auf sich beruhen lassen. Wenn ich mir vergegenwärtige, was mit mir geschieht, wenn ich an einem Text von Mircea Cărtărescu sitze und ihn übersetze, kann ich Ihnen einen Bericht schreiben, der etwa die Länge des Buches hat, das ich soeben übersetze. Weil wir aber diesen Raum hier nicht haben, werde ich mich beschränken und zu verknappen (abstrahieren) versuchen. Erzählen muss ich trotzdem.
Als ich den kleinen Roman Travestie [2] übersetzte, hatte ich das beglückende Erlebnis, einen nicht unbedeutenden Teil meiner eigenen Kindheit und frühen Jugend mitbeschrieben vorzufinden und somit in meinem Deutsch des Cărtărescu-Textes miterzählen zu können. Ich hatte (nur vier Jahre älter als er) die gleichen Ferienlager-Erlebnisse, meinte den Geruch der Schlafräume und der Speiseräume im Text zu riechen, bin während der Dauer dieser Arbeit immer wieder mit Träumen oder plötzlich auftauchenden Erinnerungen konfrontiert worden, die mir etwas aus meinem Leben erzählten, das ich vergessen zu haben meinte. Das Buch und meine Arbeit daran waren ein Schlüssel zu mir selbst, schlossen Bereiche in mir auf, die längst verschüttet waren. Ich hatte plötzlich die rumänischen Schlager jener Jahre im Ohr, die Filme vor Augen, die Straßensituationen bei uns auf dem Dorf, im nahen Lippa (rum. Lipova) und in Temeswar, ich meinte die „Napolitane“ und „Eugenia“ jener Jahre schmecken zu können und sah die kleinen Stückchen der „Ciocolata Pitic“ [3] wieder. Dies wäre ohne die Arbeit an diesem Buch nicht geschehen. Angestoßen von jenem Erlebnis ist ein Erinnerungsreservoir in mir geöffnet worden und offen geblieben, zu dem ich nun Zugang habe, und in dem sich noch einiges mehr befunden hat als das, was sich mit den Realien jenes kleinen Romans verband – der eigentlich ganz groß ist, schließlich ist er der Nukleus zur Orbitor-Trilogie [4].
Jenseits dessen, aber gewiss nicht ganz unbeeinflusst davon, ist mir im Laufe der Jahre Mircea Cărtărescus Selbstkonstruktion, der Mircea aus der Orbitor-Trilogie und der davon durchaus zu unterscheidende Erzähler in Solenoid, die durch alle Unterschiede hindurch sich nun doch wieder zu einer autofiktionalen Konstruktion verbinden, die mit ihrem Erfinder, Autor und Regisseur sehr vertraut, ja familiär verbunden sind, zu einer realen Gestalt geworden, die ich bei unseren Begegnungen durchaus mit Mircea Cărtărescu abgleiche. Und oftmals verwischen sich dann Fiktion und Wirklichkeit, Erinnerung und Einfall, Erfahrung und Phantasmagorie.
Und doch gibt es hin und wieder auch das, was Sie mit „fremdem Denken“ bezeichnen. Eine Befremdung in der großen Lineatur der Erzählung. So wurde ich von der allerletzten Episode des Romans Solenoid völlig überrascht, wiewohl sie gewiss nicht unvorbereitet „vom Himmel fällt“. Ich hatte solches schon auf uns zukommen gespürt, es beim Übersetzen aber verdrängt (dazu müssen Sie wissen, dass ich zumeist die Bücher, die ich übersetze vor dem Beginn der Arbeit nur angelesen habe, sie niemals vollständig lese, bloß so 20 bis 40 Seiten, um zu sehen, ob mir der Ton und die Erzählweise behagen, ich möchte mich beim Übersetzen schließlich nicht langweilen), und als es dann zu jenem Abschlussbild mit Mutter und Vater und Kind in der Kapelle im Wald kam, war ich durchaus eine Weile ungehalten. Nun hatten wir gerade diese wunderbare Höllenfahrt als Aufstieg in den Himmel – oder umgekehrt, den Aufstieg in den Himmel als Höllenfahrt –, und dann kommt dieses hoffnungsfrohe Trostbild. Das widerspricht meiner Weise, mein In-der-Welt-Sein zu betrachten, es widerspricht meinen Wünschen und Erwartungen an die Literatur („Eine Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat.“ Friedrich Dürrenmatt [5]). Aber das war wahrscheinlich das kleine Stückchen Gegengewicht, das Mircea Cărtărescu selber brauchte, um all die Katastrophen, von denen er in diesem Buch spricht und die nicht zuletzt ihn selbst bis heute (als Traumata etwa) bedrängen, aushalten zu können. Warum sollte ich es dann nicht aushalten?
LC: Es ist ein Markenzeichen der Beschreibungskunst Mircea Cărtărescus, dass er eine Prosa voller sinnlicher Dichte schreibt. Er behandelt die Sprache selbst als sensorisches Material und inszeniert seine Literatur als multidimensionalen Spielraum, als Erlebnisangebot für die perzeptive Imagination: Der Leser (und der Übersetzer als ein privilegierter Leser erst recht, wie Sie soeben bestätigt haben) sieht, hört, riecht, schmeckt, fühlt die geschilderten Erinnerungen und Landschaften in einer Synergie der Sinne mit. Cărtărescus Texten wohnt eine Intensität inne, welche die Leserschaft nicht selten in eine „rauschhafte“ Stimmung versetzt, wie vielfach in Rezensionen erwähnt wird. Wie verschafft man einem solchen Original (sensorische) Präsenz in der Zielsprache?
EW: Ich weiß nicht, ob ich diese Frage hinreichend werde beantworten können, schließlich nehme ich beim Übersetzen all dies, von dem Sie hier sprechen, nicht recht wahr. Was nicht heißt, dass ich die Phänomene leugnen wollte, von denen Sie sprechen. Nur nehme ich sie im Arbeitsprozess so nicht wahr. Schließlich bewege ich mich beim Übersetzen unterhalb dieser Phänomene und Effekte, auf der Ebene der Worte und Klänge, der Töne und Rhythmen, die stimmig zueinander finden sollten. Und ich muss darauf vertrauen, dass ich solcherart – schier selbsttätig, jedenfalls weitgehend absichtslos – zu den Ergebnissen gelange, um die es geht. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus einer Arbeit geben, an die ich mich noch gut erinnern kann; es betrifft kein Buch von Mircea Cărtărescu, sondern einige Passagen aus Varujan Vosganians Roman Buch des Flüsterns, [6] in dem es in vielen Details um den Völkermord der Türken an den Armeniern geht. Dazu wurde ich hin und wieder bei Veranstaltungen von Personen aus dem Publikum gefragt, wie es mir erging, als ich die schrecklichen Massaker-, Mord-, Hunger- und Qualszenen übersetzt habe, wie man so etwas aushalte, als Leser könne man ja, wenn etwas zu drastisch für einen wird, die entsprechenden Seiten überblättern … Hier konnte ich die Leute beruhigen (oder aber ich enttäuschte sie). Ich wusste zwar, dass es diese Horrorszenen im Roman vielfach gab, aber beim Übersetzen hatten sie mich überhaupt nicht irritiert. Und zwar aus dem gleichen Grund wie im Falle von Mircea Cărtărescus sinnlicher und sensorischer, „rauschhafter“ Sprache. Als Übersetzer muss ich die Eigenheiten des Originals im Deutschen nachbilden oder parallel erschaffen, „nachschöpfen“ hätte man früher gesagt. Und dieses Nachbilden findet – wie weiter oben schon gesagt – auf der Ebene der Worte und Klänge und Töne und Rhythmen statt. Es ist Arbeit in und an der Mikrostruktur und für die Dauer dieser Arbeit abgelöst vom Ergebnis, den gewünschten Effekten. Ja es geht so weit, dass mir dabei überhaupt nicht bewusst ist, welcher Effekt hier oder dort erzielt werden soll. Dies merke ich erst wieder, wenn ich einige Zeit nach der Übersetzungsarbeit solche Passagen wieder (und möglichst mit fremdem Blick) lese. Dann kann es vorkommen, dass ich an dieser Stelle noch ein Wort einfüge oder eines streiche. Aber dies geschieht ähnlich auch bei Passagen, die weniger dicht, rauschhaft oder musikalisch (beziehungsweise schrecklich, inhuman und entsetzlich) sind. Im Text muss ein Schwerthieb in einem Sekundenbruchteil durch einen Hals fahren, so dass der Kopf des Gehenden noch einige Schritte lang auf dessen Hals sitzt und erst nach einem Stolper zu Boden fällt. Dies muss so leicht und selbstverständlich klingen, dass sich auch das Entsetzen darüber beim Leser erst zwei Sätze später einstellt, wenn der Blick schon auf ein nächstes Opfer oder schon wieder auf den ungerührt danebenstehenden Baum fällt. Und damit ich diesen Effekt erreiche, darf ich ihn nicht erreichen wollen. Der große deutsche Fußballer Gerd Müller wurde mal in einem Interview gefragt, woran er denke, wenn er ein Tor schieße. Seine Antwort war: „Würde ich in diesem Moment etwas denken, dann würde ich kein Tor schießen.“ Denken, Überblicken und Wollen kann ich beim Übersetzen in den Passagen, die leicht von der Hand gehen. An den Stellen, wo es höchst intensiv wird, muss ich tun oder geschehen lassen – vielleicht aber auch nur in das vertrauen, was beim Tun ohnehin geschieht.
LC: Sie beschreiben Ihre Übersetzungsarbeit in einer vorwiegend auditiven Terminologie als Tätigkeit „auf der Ebene der Worte und Klänge, der Töne und Rhythmen“. Viele Übersetzungswissenschaftler betonen „l’importance capitale du paradigme musical“ (Jean-René Ladmiral) [7] für das Übersetzen, andere vergleichen den zu übersetzenden Text mit einer „Partitur“ (Fritz Paepcke) [8], die in der Zielsprache zum Klingen zu bringen ist. Wie wissen Sie, dass Ihr deutscher Text „stimmig“ ist beziehungsweise wie gewünscht – es ist ja Ihre Interpretation, Ihre Aufführung – „tönt“? Lesen Sie Ihre Übersetzung auch laut?
EW: Ich habe im Gymnasium in Temeswar begonnen, Gedichte zu schreiben, und zwar infolge ausgiebiger Gedichtlektüren in Deutsch, Rumänisch und Englisch (hier vor allem Shakespeare) – sehr viel jenseits des schulischen Kanons. Zuerst waren meine eigenen Gedichte eher von einem bestimmten Mitteilungswillen geprägt, weniger formbewusst hinsichtlich des Rhythmus und Klangs der Verse. Dies sollte sich aber bis etwa zu meinem dreißigsten Lebensjahr ändern. Nun gab es in den Gedichten auch Reime (eher in der verhalteneren Form der Assonanz oder des Binnenreims), Rhythmus, Melodie, und wenn es dann auch das noch darin gab, was man als Mitteilung bezeichnen könnte, so war es von der Form nicht ablösbar. Natürlich habe ich beim Gedichteschreiben mir diese laut vorgelesen und, was ich hörte, daraufhin befragt, wie es weitergehen könnte. Die Form war das Medium geworden, mittels dessen ich Regionen in mir selbst aufschließen und in Text münden lassen konnte, von denen ich nicht so recht wusste, dass es sie in dieser oder jener Gestalt überhaupt gab.
Wenn ich heute Mircea Cărtărescu übersetze und da oder dort Zweifel am Text habe, lese ich mir diese Passagen laut vor. Ansonsten vertraue ich darauf, dass ich die Rhythmus und Klang tragenden Elemente – Vokale vor allem, aber auch manche vokalbestimmte Silben – so setzen kann, dass der gewünschte Klang entsteht. Das ist wahrscheinlich vergleichbar mit der Arbeitsweise so mancher Komponisten, die ihre Musiken ohne Klavier schreiben können und beim Schreiben mit den Augen hören.
Nun besteht ein literarischer Text gewiss nicht allein aus Melodie und Rhythmus, auch lebt Übersetzung erst einmal davon, dass jemand, der oder die übersetzt, Ausgangs- wie Zielsprache und -kultur so gut wie irgend möglich kennt. Was das Vokabular, die Lexik, Redewendungen, Sprichwörter et cetera betrifft, so bin ich, der ich schon im Kindergarten zweisprachig aufzuwachsen begann, noch kaum einer unlösbaren Schwierigkeit begegnet. Und seit ich im Besitz des 19-bändigen Wörterbuchs der rumänischen Sprache bin, das historisch den Sprachbestand des Rumänischen verzeichnet, kann man nur noch beim Übersetzen von Mircea Cărtărescu in Schwierigkeiten geraten, der durchaus Neologismen erfindet, denen nur schwer beizukommen ist. Es hat vor einigen Jahren einmal den Fall gegeben, dass ich ihn nach einem Wort in einem seiner Texte fragen musste, worauf ich ein paar Tage später von ihm die Antwort bekam: „Ich weiß auch nicht, warum die Leute glauben, ich wüsste über alle Wörter Bescheid, die in meinen Texten vorkommen. Finde selber eine Lösung für diese Stelle, und es wird OK sein.“ Was allerdings nach wie vor spürbar fehlt und das Übersetzen aus dem Rumänischen schwieriger gestaltet als es sein müsste, ist eine in rumänischer Sprache verfasste Enzyklopädie, ein allgemeines Nachschlagewerk, in dem das Weltwissen in rumänischer Sprache verzeichnet ist.
Zur gleichen Alterskohorte mit dem zu übersetzenden Autor zu gehören, ist vor allem für die Übersetzung der autobiografischen beziehungsweise quasi-autobiografischen Passagen seiner Bücher von großem Vorteil. Man kennt aus eigenem Erleben die beschriebenen Phänomene: weiß, wie die Krankenhäuser in den 50er- und 60er-Jahren in Rumänien ausgesehen haben, kennt alle Gerüche – auch der Grippeimpfungen, Reinigungsmittel, eingelassenen Fußböden in Schulen und öffentlichen Gebäuden –, man ist vertraut mit der kompletten Infrastruktur der Städte, mit den Bussen und Straßenbahnen, mit den Eisenbahnen, mit den ersten Fernsehern und den großen Radioapparaten in ihren furnierten Holzkisten und dem tausendfach beschriebenen „grünen Auge“, mit dem Rauschen und Knattern der Sendersuche und den unendlich vielen Ortsnamen auf der gläsernen Platte. Man hat die gleichen Fernsehserien in Kindheit und Jugend gesehen, die gleichen Schlager gehört, Kekse gegessen und Limonaden getrunken. Man hat die Propagandaslogans der Partei vor Augen und die Witze ihrer Verächter in den Ohren. Hier genügt die eigene Erinnerung, und falls diese sich nicht sogleich einstellen sollte, genügen ein paar Seiten weiterer Lektüre im Original.
LC: Die Vertrautheit mit der Lebenswelt des Autors erleichtert dem Übersetzer zweifelsohne das Verstehen des Originaltextes und den Zugang zu seinem „Ton“, wobei der Ton nicht nur die musikalische Qualität eines Textes betrifft. Dieser Begriff und andere verwandte Termini stehen zugleich für die unverwechselbare Identität eines Autors: Jeder Schriftsteller hat „seinen Tonfall“ (Curt Meyer-Clason) [9], durch die Bücher eines Autors geht ein „Grundton“ (Ilma Rakusa) [10], der jedes seiner Werke unverkennbar als (nur) zu ihm gehörend erkennen lässt. Man spricht oft ebenfalls vom „Sound“ eines Schriftstellers (Ilma Rakusa), der die wesenseigenen Merkmale seines Diskurses in sich vereint. Den Ton eines Textes aufzuspüren, heißt in diesem Zusammenhang, Zugang zu der intimen Textur des Werks und somit zur Identität seines Autors zu finden. Woran erkennt man den Cărtărescu-Sound und in welcher Weise haben Sie versucht, ihn in der Übersetzung (zum Beispiel von Solenoid) nachzuschöpfen?
EW: All dieses Reden vom „Ton“, dem „Tonfall“, „Grundton“ und „Sound“, und was es sonst noch an Hilfsformulierungen geben mag, bemäntelt ja nur ein Dilemma, die Unfähigkeit, das Problem genauer zu beschreiben. Im Juristischen heißen diese Formeln Generalklauseln – sie meinen vieles und treffen nichts wirklich genau. Und sie sind populär, weil alle sie bequemlichkeitshalber benutzen. Wenn ich nun damit beginne, müsste ich hier vorführen, dass auch genauer gesprochen werden kann. Aber warum sollte ich dies tun? Reicht es denn nicht, dass ich mich beim Übersetzen eines Werkes gehörig anstrenge? Muss ich jetzt noch eine Form der Selbst- und Textanalyse praktizieren, die mir widerstrebt? Ich kann berichten, dass ich auch schon Autoren übersetzt habe, deren Sprechweise mir mit der Zeit gehörig auf die Nerven ging. Das hatte nichts mit der literarischen Qualität des Autors oder der Autorin zu tun, sondern mit Eigenheiten des Satzbaus, mit präferierten Erzähltechniken, die sich immerzu wiederholten und vom Übersetzer nichts als Fleiß und braves Nachbilden erforderten. So etwas ermüdet und quält einen über das Maß des bei diesem Tun Erträglichen hinaus. Und wenn man dann die Autoren auch noch kennt und feststellt, dass es kaum eine Differenz zwischen den quälenden Aspekten ihrer literarischen Erzählweise und ihren persönlichen Kommunikationsformen gibt, dann muss man (nein, nicht man: ich) versuchen, Distanz zu gewinnen, unter Umständen auch darauf verzichten, weitere Bücher oder Texte dieser Autoren zu übersetzen. Nun könnte ich sagen, dies liege am „Grundton“ dieser Person wie des von dieser Person geschaffenen Werks. Aber bei dem einen Autor liegt es an einer komplizierten, meinem Sprachgefühl völlig widersprechenden Syntax nebst komplett fehlender Musikalität der Texte wie der Person. In einem anderen Fall liegt es an der mangelhaften intellektuellen Durchdringung des Stoffes im Verlauf des Erzählens, was zu grobianisch verkürzten Darstellungen führt, ohne durch solche Verfremdungen Tempo oder Stimmung oder sonst eine Form der Intensivierung zu erreichen, was mich aber beim Übersetzen auf das intellektuelle Niveau eines Vorschulkindes reduziert. Solche Autorenkritik seitens des Übersetzers ließe sich noch ausführlicher vorbringen, hier wollte ich lediglich von der Negativseite her den Versuch machen, den sogenannten „Ton“ des Autors ein bisschen in seine Teilaspekte auseinanderfallen zu lassen.
Natürlich ließe dieser sich auch positiv beschreiben. Ich möchte jedoch an den Stellen, an denen ich das Gefühl (und nicht nur das Gefühl) habe, dem Werk eines Autors durchaus eine angemessene Sprache im Deutschen verliehen (oder auch nur gefunden) zu haben, mein Tun nicht aufdröselnd beschreiben. Jetzt jedenfalls noch nicht. Mag sein, dass mich künftige Bücher von Mircea Cărtărescu so irritieren, etwa indem sie mir vorführen, nichts als die permanente Wiederkehr des Gleichen zu praktizieren, dass sie mich dazu bringen, in mir einen intellektuellen Prozess gegen sie (ihren „Ton“) anzustrengen. Dann wäre ich gewiss in der Lage, mich ganz anders darüber zu äußern.
LC: In einer Radiosendung, die unter anderem vom vielschichtigen, komplexen Verhältnis von Literatur und Musik handelte, wurde der Literaturkritiker Dan C. Mihăilescu gefragt, mit welchem Komponisten beziehungsweise Musikstück er einige rumänische Klassiker in Verbindung bringen würde. Mihai Eminescus Dichtung korellierte er spontan mit der Musik Frédéric Chopins, Constantin Noicas philosophische Schriften mit Beethovens 5. Symphonie, Tudor Arghezis Psalmen mit Tomaso Albinonis Adagio g-Moll, Mircea Cărtărescus Erzählung Der Architekt mit Carl Orffs Carmina Burana. Wenn Sie sich auf diese Fragestellung nicht akademisch-analytisch, sondern spielerisch-intuitiv einlassen würden, mit welchem Musikstück oder Komponisten würden Sie Mircea Cărtărescus Solenoid assoziieren und warum?
EW: Wie Sie wissen, ist der Protagonist des Romans Solenoid sehr nah mit dem Autor des Buches verwandt, sie sind gleich alt, der namenlose Protagonist ist Rumänischlehrer an einer Schule in Bukarest, an der auch Mircea Cărtărescu Ende der Siebzigerjahre seine erste Stelle als Lehrer hatte, die Kindheitswohnung der beiden ist die gleiche et cetera. Also werden jener Lehrer und dieser Autor selbstverständlich die Musiken ihrer Generation gehört haben – den Rock-Pop der späten Siebzigerjahre. Die frühen Beatles und Stones und Pink Floyd waren da schon Klassiker. Wir wissen, dass Mircea Cărtărescu vor ein paar Jahren einen Band mit Übersetzungen der Songtexte von Bob Dylan veröffentlicht hat, also dürfen wir annehmen, dass er dies nicht getan hätte, wenn er Bob Dylan nicht mögen würde. Wiewohl er nicht recht einverstanden war mit dem Literaturnobelpreis für Bob Dylan. Worin ich ihm durchaus zustimme, schließlich gibt es deutlich bessere Dichter in den USA als Bob Dylan und Louise Glück. Aber damit bin ich noch immer nicht bei einer Musik, die ich dem Roman Solenoid zuordnen würde. Ich könnte mir ein großes collagiertes Musikstück vorstellen, das aus Musiken von Pink Floyd, aber auch von David Bowie, vom Album Cantafabule der Band Phoenix [11], tatsächlich auch aus der Carmina Burana, aber auch aus Bach und Gezwitscher von Monteverdi besteht. Allerhand Manieristisches könnte noch darunter gemixt sein und Gesprochenes – hier pathetische Ansprachen in allen erdenklichen Sprachen: Laudationes auf verdiente Volkserzieher. Sie erinnern sich vielleicht an die Porträts der mazedonischen Gelehrten, der aserbaidschanischen, bulgarischen oder slowakischen Genies, die – pflichtschuldigst von Fliegen beschissen – an den Wänden des Lehrerzimmers in Solenoid hängen. Jede dieser verdienten Persönlichkeiten sollte in der großen Melodie Fragmente einer höchst pathetischen Laudatio auf sich selbst in seiner eigenen Sprache hören können – gesprochen von den größten Staatsschauspielern der jeweiligen Nation. Dann auch Baggerlärm, einstürzende Altbauten, die Pickhammer, die Straßen aufstemmen und Häuserwände demolieren, die Sirenen der Rettungswagen, Polizeisirenen, hin und wieder ein paar Schüsse aus automatischen Waffen, romantische Streicher, einzelne Verse aus Dylan Thomas’ großem Gedicht Do not go gentle into that good night – und immer so weiter. Möglichst nicht synchronisiert mit dem Stimmungsverlauf im Roman, am besten schroff dagegen. Am Ende nur Krächzen in den tiefsten Cellotönen. Über das gesamte – wie ich finde – missratene Ende: die heilige Familie der himmlischen Höllenfahrt entronnen, gerettet und in Liebe vereint in der Ruine einer im Wald vergessenen Kapelle. Mehr Kitschrosa geht nicht: Hier also das Cellosaitenkrächzen immer lauter werdend bis an die Grenze der Unerträglichkeit. Musik aus, Roman zu.
LC: Sie lesen die Bücher, die Sie zu übersetzen haben, vor dem Beginn der Arbeit nur an, dann beim Übersetzen nur in kleinen Portionen von 20–40 Seiten, damit Sie Ihre intellektuelle Neugier wachhalten. Sie beschreiben den Übersetzungsprozess als einen Lese- (und freilich auch Schreib-) Akt, bei dem Ihr inneres Auge sowie Ihr Ohr stark beansprucht werden. Ich würde Sie gerne bitten, näher auf diesen Punkt einzugehen: Lesen Sie die Werke, die Sie zu übersetzen haben, anders als die Bücher, die Sie aus eigenem Interesse lesen? Gibt es aus Ihrer Sicht eine spezifische translatorische Lektüre?
EW: Ich weiß nicht, ob es eine spezifische translatorische Lektüre gibt, ich nehme zwar an, dass Übersetzer Texte in der Sprache, aus der sie übersetzen, mit anderen Aufmerksamkeitselementen gespickt lesen als andere Texte. Und ich weiß, dass ich Texte, die aus Sprachen übersetzt sind, die ich nicht beherrsche, mitunter auch mit Bruchstücken meiner Übersetzerlinsen betrachte. Wie oft kommentiere ich eine stilistisch nicht überzeugende Stelle oder einen logischen Wackelkontakt mit: offenbar schlampig oder falsch übersetzt … Die Texte, die ich zu übersetzen habe, lese ich tatsächlich etwas anders als jene Texte, die ich als schlichter Leser von Literatur zur Hand nehme. Während ich bei Letzteren darauf warten kann, dass der Text mich für sich gewinnt, er mich zwingt, ihm weiter zu folgen, ich beinahe naiv (mit einer Art zweiter oder dritter Naivität) darauf warten kann, vom Text „verführt“ zu werden, prüfe ich im Fall des zu übersetzenden Textes diesen vom ersten Satz an auf Aussage, Funktion, Strategie, Plausibilität der Absicht-Mittel-Relationen und nicht zuletzt auf die Übertragbarkeit all dieser Dinge in meinen Denkhorizont und damit letztlich in die deutsche Sprache sowie einen deutschsprachigen kulturellen Kontext. Aber – um ein Missverständnis zu vermeiden – diese „Prüfung“ geschieht nicht systematisch und auch nicht streng rational, sie ereignet sich vielmehr, wahrscheinlich infolge jahrzehntelangen zweisprachigen Lesens nebst Einübung ins Übersetzen. Vermutlich lesen auch Nichtübersetzer, wenn sie zweisprachig kulturell sozialisiert sind, einen Text in der einen Sprache stets mit der Denk- und Sprechweise der anderen Sprache im Hintergrund. Dass dies bei mir gewiss der Fall war, weiß ich seit (jetzt eigentlich, da ich es hier niederschreibe) meiner Gymnasiastenzeit in Temeswar, wo sich der Unterricht in rumänischer Literatur(geschichte) in nichts von dem der deutschen Literatur(geschichte) unterschied. Und wo ich vor allem die neuere rumänische Literatur (die Erzähler des 20. Jahrhunderts) ganz gewiss auch mit deutschen Augen und Ohren gelesen habe. Nie jedoch habe ich die deutsche Prosa dieser Zeit mit rumänischen Augen betrachtet, wiewohl ich einem rumänischen Freund, der nach dem Abitur Philosophie studieren sollte, ausführlich von meinen deutschen Lektüren berichtet und ihn auch mit den aktuellsten Texten, derer ich (weit außerhalb des schulischen Kontextes) habhaft werden konnte, vertraut machte. Doch war dies nicht im strengen Sinne Übersetzung, sondern Vermittlung kultureller Inhalte sowie ideologischer Konterbande.
Beim Übersetzer verfeinert sich dieses beinahe automatische „In-zwei-Sprachen-Lesen“, es verfeinert sich einerseits, und es bekommt einen weniger feinen, nämlich pragmatischen Aspekt, der schon in Richtung Verfahrensweise, das heißt, übersetzerische Praxis schielt. Auch stellen sich erste Fragen der interkulturellen Plausibilität oder Verträglichkeit – zwar auch noch nicht ganz manifest, aber subkutan, sie schwimmen, schwingen mit beim Lesen, bis sie obenauf sind und sich nicht mehr abweisen lassen. Dann steht man vor dem ersten Arbeitsschritt – und das Lesen hat alle Unbefangenheit verloren. Und von dieser Stelle an kommt es nur noch selten vor, dass man zurückfindet zu einem unbefangenen und genussvollen Lesen – in seltenen Augenblicken, wenn das „kritische“ Lesen erlahmt, wenn es dem Text gelingt, alles professionelle Werkzeug einem aus dem Kopf zu schwemmen, wenn mithin eine Naivität (nunmehr 4ten Grades?) einsetzt, weil der Text seine Macht zurückgewonnen hat, ereignet sich eine lesende Abschweifung aus der Rolle, ein Rückfall, die so feuchtwarmsüße Regression … Gäbe es diese Momente nicht, wo käme dann die Überzeugung her, dass es nach wie vor Texte gibt, die all jene Anstrengungen lohnen, von denen wir nun schon seitenweise sprechen.
LC: Sie üben seit Jahrzehnten eine doppelte Tätigkeit als Schriftsteller und Übersetzer aus. Der Übersetzer in Ihnen – das haben Sie uns soeben wissen lassen – liest kritisch mit, wenn Sie ein literarisches Werk zur Hand nehmen. Wie verhält es sich nun mit Ihrem eigenen literarischen Schreiben: Hat der intensive Dialog, ja das „Zusammenleben“ mit den übersetzten Autoren und Werken Auswirkungen auf Ihren eigenen Schreibstil, auf Ihr eigenes literarisches Werk? Finden zwischen dem Übersetzer und dem Autor Ernest Wichner „geheime“, unterschwellige künstlerische „Transaktionen“ [12] ebenfalls statt?
EW: Ich habe zwar immer mal wieder in den vergangenen Jahrzehnten literarische Texte verschiedenster Art veröffentlicht, aber zu keiner Zeit dauerhaft als Schriftsteller gelebt. Dafür war ich vielleicht zu unruhig (neugierig?) und nicht ehrgeizig genug. Aber ich habe niemals in meinem Erwachsenenleben beruflich etwas getan, das nichts mit Literatur zu tun hatte. So hat es auch eine Zeit gegeben, in der ich stärker als Literaturkritiker für Rundfunk und Zeitungen tätig war, und eine Zeit – die ersten zwei Jahrzehnte im Literaturhaus Berlin – in der ich im Hauptberuf eher Literaturhistoriker war: als ich zusammen mit Herbert Wiesner dort regelmäßig Ausstellungen und die dazu gehörenden Ausstellungsbücher erarbeitet habe.
Alles was man tut, hat in irgendeiner Weise einen Einfluss auf das, was man selber äußert und wie. Dies ist ganz gewiss eine Banalität, aber hinsichtlich Ihrer Frage auch mein Versuch, irgendwie Land zu gewinnen, Sie so lange hinzuhalten, bis mir etwas dazu einfällt. Natürlich weiß ich, dass ich den einen oder anderen Text ohne diesen oder jenen Gedichtzyklus von Gellu Naum wahrscheinlich nicht geschrieben oder ganz gewiss nicht so geschrieben hätte, aber das trifft auch auf die Gedichte von Oskar Pastior zu, mit denen ich nicht als Übersetzer „zusammenleben“ musste. Und in jüngeren und ungestümen Jahren auch auf Brecht und Arp und Helmut Heißenbüttel und noch etliche andere. Sie sehen, es gibt Einflüsse, von denen weiß man, die lassen sich benennen und auch an bestimmten Textstellen nachweisen, aber daneben gibt es Beeinflussungen, die sind nicht weniger erheblich, aber man selbst weiß nicht zu sagen, woher sie rühren. So gibt es in einem meiner Gedichte ein verändertes Zitat, das ich jahrelang für ein Rilke-Zitat gehalten hatte, bis ich feststellte, dass es aus einem Gedicht von Nietzsche stammte. In den meisten Fällen (die Blecher-Texte und Gellu Naums Gedichte ausgenommen) sind die rumänischen Texte, die ich zu übersetzen hatte, in ihrem Charakter (was ist das nun wieder?) so sehr anders als die deutschen Texte, die mich besonders berühren, dass sie mich oder meine Absicht, eigene Texte zu schreiben nicht beeinflussen können. Das Übersetzen rumänischer Texte aktiviert so etwas wie eine alternative Existenzweise in mir, eine parallele Biografie, deren Sensationen und Phantasmen – aber auch Realien, Zumutungen und Ärgernisse – mir einen potentiellen Doppelgänger an die Seite stellen, dessen Volten ich neugierig beobachte. Habe ich nun erklärt oder mystifiziert? Wahrscheinlich weder-noch. Ich habe lediglich zu beschreiben versucht, was ich nicht erklären oder analysieren kann.
LC: Ihrer Tätigkeit im Literaturhaus Berlin und Ihren zahlreichen Übersetzungen ist es zweifelsohne zu verdanken, dass die rumänische Literatur in den letzten Jahrzehnten dezidiert mehr Präsenz in der deutschen literarischen Öffentlichkeit zeigte. Zwar gibt es für die rumänische Belletristik immer noch kein vergleichbares Projekt wie die Polnische Bibliothek bei Suhrkamp, wie Sie vor längerer Zeit angeregt haben, doch faktisch wie kulturpolitisch entwickelte sich in der jungen Vergangenheit eine gewisse Dynamik, die der rumänischen Gegenwartsliteratur Profil verleiht und sie fortwährend „beyond the nation“ (Christian Moraru) [13] bekannt macht. Wie schätzen Sie das aktuelle Interesse an rumänischer Literatur im deutschen Sprachraum ein und was könnte und sollte Ihres Erachtens noch unternommen werden, um weitere Aufmerksamkeitsschübe in der Rezeption dieser Literatur in Deutschland zu erreichen?
EW: Ich glaube, das literarische Interesse einer „Öffentlichkeit“ oder irgendwelcher Publikumsgruppen bewegt sich stets „beyond the nation“ oder „hinternational“, wie Claudio Magris es in seinem Donau-Buch so schön sagte. Tatsächlich aber ist das literarische Interesse noch viel kleinteiliger strukturiert, ja individualisiert. Aber als Individualisiertes lässt es sich nicht mehr richtig beschreiben. Oder – besser gesagt – nur noch in anderen Kategorien beschreiben, die von Ihrer Frage allerdings wegführen. Weil ich mir vor etwa 20 Jahren schon die Frage gestellt hatte, was man hier tun könnte, um ein einigermaßen von Kenntnissen gestütztes Interesse an der rumänischen Literatur zu ermöglichen (herbeiführen kann man es ohnehin nicht), bin ich auf das Projekt einer analog zur Polnischen Bibliothek gedachten Rumänischen Bibliothek gekommen und habe dieses Projekt bei einem Aufenthalt in Bukarest auch dem damaligen Direktor des Rumänischen Kulturinstituts, Horia Roman Patapievici, vorgestellt. Er war sofort davon begeistert und hat spontan gesagt, er, das heißt das Kulturinstitut, würde es bezahlen. Diese Begeisterung hat mich natürlich gefreut, aber was die Bezahlung betrifft, habe ich ihm mit dem Hinweis widersprochen, dass man keine unerwünschten Geschenke machen sollte: Wenn es mir gelingt, aus Deutschland (beziehungsweise im deutschen Sprachraum, zu dem ja auch erhebliche Teile der Schweiz und Österreichs gehören) mindestens die Hälfte der benötigten Projektsumme zu besorgen, was ich als Ausdruck dafür nähme, dass man sich eine solche Bibliothek hier ebenso wünscht, dann wäre der Beitrag des Rumänischen Kulturinstituts höchst willkommen. Darauf hatten wir uns geeinigt, und ich habe ein Programmkonzept für diese Bibliothek erarbeitet, habe Mitarbeiter angesprochen und gewonnen, einzelne Projekte dafür in Auftrag gegeben und selbst begonnen. So arbeite ich (nebenher) immer wieder an einer umfangreichen Anthologie der rumänischen Avantgardeliteratur, ohne die ich mir ein solches Projekt nicht vorstellen kann und will. Aber ich fürchte, für mich ist dieses Projekt vorerst gestorben. Denn nachdem die an Kultur offenbar komplett desinteressierte rumänische Politik das Rumänische Kulturinstitut zerstört hatte, ist auf dieser Seite der Partner weggebrochen, und hier bei uns haben sich die Verhältnisse in den Verlagen in einer Weise verschlimmert, dass man sehr viel mehr Energie, Durchsetzungs- und Überzeugungsvermögen besitzen müsste, als ich sie besitze, um einem solchen Projekt noch einmal die Chancen zu erwirken, die es vor zehn Jahren noch hatte. Ich werde jedenfalls kein Buch übersetzen, das nur noch digital vorgehalten werden soll und erst recht keine ganze „Bibliothek“ betreuen, die kein Mensch greifen kann.
Was man aber nach wie vor tun kann für die rumänische Literatur, ist, sie so gut es irgend geht zu übersetzen und bei anständigen Verlagen zu veröffentlichen. Auch wenn sie einem dort nicht aus den Händen gerissen werden, gibt es genügend Chancen, die Bücher, die einem tatsächlich wichtig sind, so unterzubringen, dass sie auch gesehen und beachtet werden. So ist letztlich auch Gabriela Adameșteanus Verlorener Morgen in der Übersetzung von Eva Wemme [14] (ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse) deutlich und – wie ich hoffe – nachhaltig ins Bewusstsein der hiesigen Leser gedrungen; ich habe es selber mit Varujan Vosganians Buch des Flüsterns und mit Cǎtǎlin Mihuleacs Oxenberg & Bernstein, [15] die ebenfalls für den Preis der Leipziger Messe nominiert waren, erlebt, welche Resonanz für die Autoren und ihre Bücher dadurch entstehen kann. Auch Georg Aescht, der Liviu Rebreanus Roman Der Wald der Gehenkten [16] für die geplante Rumänische Bibliothek übersetzt hatte, war mit dieser Übersetzung für den Preis der Leipziger Messe nominiert. Der Preis und daneben noch all diese Nominierungen in kurzer Folge haben eines auf jeden Fall sichtbar werden lassen: dass es auf die Qualität der Texte und ihrer Übersetzungen ankommt. Wenn beides stimmt, ist die Grundvoraussetzung für ein Publikumsinteresse erfüllt – was dann noch nötig ist, ließe sich zwar auch noch benennen, entzieht sich aber unseren Einflussmöglichkeiten.
LC: Mit diesem Gedanken – der Weg zu einer guten internationalen Resonanz der rumänischen Literatur führt über gute Übersetzungen – wollen wir unser Gespräch abschließen. Durch Ihre hervorragenden translatorischen Leistungen haben bedeutende rumänische Autoren – unter anderen Mircea Cărtărescu – Eingang in die deutsche Sprache und Literatur gefunden. Sie haben sie auch anders als in früheren Übersetzungspraktiken an das deutsche Lesepublikum vermittelt: Nicht dergestalt, als wären die übersetzten Werke von Thomas Mann geschrieben, nicht ihre Herkunft aus dem Rumänischen tilgend, sondern ihre Besonderheiten, ja ihre Fremdheit beibehaltend. Welche Grundsätze gehören ferner zu Ihrem translatorischen Konzept? Wie verstehen Sie Ihre Aufgabe als Übersetzer und Vermittler rumänischer Literatur im deutschsprachigen Raum?
EW: Es freut mich, dass Sie meinen Übersetzungen attestieren, sie tilgten ihre Herkunft aus dem Rumänischen nicht und behielten ihre Besonderheit und Fremdheit bei. Denn genau dies war von allem Anfang an meine Intention. Wenn ich schon beim Lesen eines Textes merke, dass die Fremdsprache, die ich gerade lese, andere Bilder in meinem Kopf aufruft als ein deutscher Text aus der gleichen Zeit und zu einem vielleicht vergleichbaren Thema, dann muss die Übersetzung dieses fremdsprachigen Textes beim deutschen Leser Aspekte dieser Fremdheit reproduzieren oder dieses Andersseins, dieses anderen Denkens, der anderen Bildsprache. Das ist mir sehr wichtig, denn es handelt sich um Literatur. Und in der Literatur lassen sich die Realien unterschiedlicher Wirklichkeiten (unterschiedlicher Länder, Kulturen und Sprachen) gut beschreiben, aber sie selbst, als Literatur nämlich, besteht eben nur zum geringsten Teil aus dem Was – also dem, wovon sie an ihrer Oberfläche handelt oder zu handeln vorgibt –, zu ihrem überwiegenden Teil besteht Literatur aus ihrem Wie, und dieses Wie transportiert die mikrostrukturellen Elemente einer Kultur, die Differenzmarker, die das Denken stimulieren, die kleinen Sensationen (unterschiedlichen Gewichtungen) in den Mentalitäten. Und diese zwischensprachlichen Differenzen dürfen zu unser aller Wohl nicht zugeschüttet, nivelliert oder getilgt werden, im Gegenteil. Wo auch immer man auf sie trifft und sie im Übersetzungsprozess als different weitertransportieren kann, sollte man dies tun. Keinesfalls natürlich, indem man den Besonderheiten in Stilistik, Grammatik, Lexik et cetera des Deutschen Gewalt antut. In den gelungensten Fällen solcher Übersetzungen ist man nicht nur näher an den Besonderheiten des Originals, sondern auch die Zielsprache wird geschmeidiger, kühner, klüger … (Hier frage ich mich, ob es denn schon germanistische oder komparatistische Studien gibt, die sich einer solchen Frage widmen – also in welcher Weise das Deutsche durch diese oder jene Übersetzung aus dem Französischen, Englischen, Russischen et cetera herausgefordert, erweitert, gedehnt, bereichert oder inspiriert wurde. (Das mit Hölderlin und Pindar meine ich nicht, auch nicht die wahnsinnige Dante-Übersetzung von Rudolf Borchardt.)
Und was die Grundsätze angeht: Ich bin mittlerweile so alt geworden in und mit meinem literarischen Gemischtwarenladen, dass ich gelernt habe, das Formulieren von Grundsätzen zu vermeiden. Wenn Sie aber einen von mir hören wollen, bitteschön, dann sage ich mit Oskar Pastior: „Nichts ersetzt das Original. Im Grunde ist ja Übersetzung nicht möglich. Übersetzung ist das falsche Wort für einen Vorgang, den es nicht gibt. In einer anderen Sprache denkst du anders, sprichst du anders, agierst du anders, bist du anders.“ [17] Zuallerletzt dann noch die Aufgabe. Sie ist – Sprache sei Dank – doppeldeutig. Ich kann sie substantivisch verstehen und mich ihr stellen wollen und ich kann sie verbal verstehen und schlicht und einfach aufgeben. Soweit ich also überhaupt etwas tun kann, will ich versuchen, mich dabei nicht zu unterfordern, Freude, Lust und ja, durchaus auch harte Arbeit zu genießen. Und wenn dann Texte entstehen, die ihre Leser erreichen, habe ich getan, was ich tun konnte.
ERNEST WICHNER ist Autor und Übersetzer und leitete zwischen 2003 und 2017 das Literaturhaus Berlin.
LARISA CERCEL forscht und lehrt im Bereich der Translationswissenschaft an den Universitäten Leipzig und Freiburg.
[1] Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, <https://www.deutscheakademie.de/de/auszeichnungen/johann-heinrich-voss-preis/ernest-wichner>, 16.7.2025.
[2] Das rumänische Original Travesti erschien 1994 im Bukarester Verlag Humanitas. Die deutsche Übersetzung Travestie wurde 2010 im Suhrkamp Verlag publiziert.
[3] „Napolitane“ sind Waffeln, i. d. R. mit Schokoladenfüllung oder auch in der Geschmacksrichtung Vanille und Zitrone. „Eugenia“ sind Sandwich-Kekse mit Kakaofüllung. „Ciocolata Pitic“ war eine sehr bekannte Schokoladenmarke im kommunistischen Rumänien. Die Schokolade hatte die Form einer Streichholzschachtel. Alle drei gelten als Klassiker unter den rumänischen Süßigkeiten. Sie zählten zu den wenigen Süßwaren, die es in der kommunistischen Zeit in den Lebensmittelläden in Rumänien zu kaufen gab.
[4] Mircea Cărtărescus Trilogie, die im Original den Titel Orbitor trägt, liegt bereits auf Deutsch vor (Teil 1: Die Wissenden, übers. von Gerhardt Csejka, Wien 2007; Teil 2: Der Körper, übers. von Gerhardt Csejka und Ferdinand Leopold, Wien 2011; Teil 3: Die Flügel, übers. von Ferdinand Leopold, Wien 2014).
[5] Friedrich Dürrenmatt: „21 Punkte zu den Physikern“. In: ders.: Die Physiker. Zürich 1962, S. 193.
[6] Varujan Vosganian: Buch des Flüsterns. Wien 2013.
[7] Jean-René Ladmiral: L’esthétique de la traduction et ses prémisses musicales. In: Tania Collani (Hg.): Variations et inventions. Mélanges offerts à Peter Schnyder. Paris 2015, S. 374.
[8] Fritz Paepcke: Im Übersetzen leben – Übersetzen und Textvergleich. Hg. von Klaus Berger, Hans-Michael Speier. Tübingen 1986, S. 56.
[9] Kurt Meyer-Clason: Vom Kaufmann zum Kulturvermittler. In: Karin Graf (Hg.): Vom schwierigen Doppelleben des Übersetzers. Berlin 1994, S. 12.
[10] Ilma Rakusa: Zwischen Einfühlung und Distanz. Zur Problematik des Übersetzens poetischer Prosa. In: Jale Melzer-Tükel (Hg.): Abenteuer des Übersetzens. Graz, Wien 1991, S. 67.
[11] Phoenix ist eine rumänische Rockband, die 1962 in Temeswar gegründet wurde. Das Album Cantafabule wurde 1975 lanciert.
[12] Vgl. Christine Lombez: Transactions secrètes. Philippe Jacottet poète et traducteur de Rilke et Hölderlin. Arras 2003.
[13] Christian Moraru: Romanian Literature Beyond the Nation: Mircea Cărtărescu’s Europeanism and Cosmopolitanism. In: World Literature Today 80 (2006) H. 4, S. 41–45.
[14] Gabriela Adameșteanu: Verlorener Morgen. Übersetzt von Eva Ruth Wemme. Berlin 2018.
[15] Cǎtǎlin Mihuleac: Oxenberg & Bernstein. Übersetzt von Ernest Wichner. Wien 2018. s.o.
[16] Liviu Rebreanu: Der Wald der Gehenkten. Übersetzt von Georg Aescht. Wien 2018. s.o.
[17] Oskar Pastior: Das Unding an sich. Frankfurter Vorlesungen. Frankfurt am Main, 1994, S. 102.