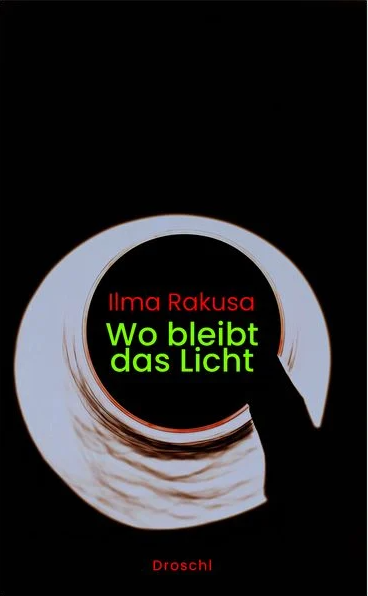Dichter:innen: Die Antikörper der Gesellschaft. Die Autorin Moni Stănilă und ihr Übersetzer Alexandru Bulucz im Gespräch
von IKGS München
Enikő Dácz spricht mit der in der Republik Moldau lebenden Autorin Moni Stănilă anlässlich der Veröffentlichung ihres Lyrikbandes „Mettalische Igel“ zunächst über ihre Erfahrungen auf der Leipziger Buchmesse, dem deutschen Publikum sowie der Literaturszene in Chișinău. Der Übersetzer des Bandes, Alexandru Bulucz, spricht über die Gemeinsamkeiten seiner lyrischen Welt mit der von Moni Stănilă, die Erfahrungen, die er beim Übesetzen gemacht hat, sowie über die „mittlere Ästhetik” der Autorin, die die Übertragung erleichtert hatte.
5. August 2025Moni Stănilă ist 1978 in Tomești, im Kreis Timiș, geboren. Sie hat orthodoxe Theologie in Temeswar/Timișoara und Sibiu/Hermannstadt studiert, lebt seit 2010 in Chișinău und leitet zusammen mit Alexandru Vakulovski den Literaturkreis Republica der Stadtbibliothek. Zu ihren Publikationen zählen u. a.die Lyrikbbände Colonia Fabricii/Kolonie der Fabrik, die 2015 erschienen ist, O lume din evantaie pe care să nu o împarți cu nimeni/Eine Welt von Fächern, die man mit niemandem teilen muss, Ale noastre, dintru ale noastre/Unseres, aus Unserem und mehrere Romane, darunter Al 4-ea/ Der Vierte, Brâncuși sau cum a învățat țestoasa să zboare/Brâncuși, oder wie die Schildkröte fliegen lernte.
Das Transkript zum Mitlesen
ED: Heute habe ich das Vergnügen und die Freude, mit Moni Stănilă in Chișinău zu sprechen. Vorab möchte ich sie in ein paar Worten unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die sie nicht kennen und die deutsche Übersetzung ihres Gedichtbandes noch nicht gelesen haben, vorstellen. Du bist 1978 in Tomești, im Kreis Timiș/ Temeswar, geboren. Du hast orthodoxe Theologie in Temeswar/Timișoara und Sibiu/Hermannstadt studiert. Seit 2010 lebst Du hier in Chișinău und leitest zusammen mit Alexandru Vakulovski den Literaturkreis Republica der Stadtbibliothek. Darüber werden wir wahrscheinlich auch ein wenig sprechen. Du hast viele Bücher veröffentlicht – ich werde jetzt nicht die ganze Liste durchgehen, aber u.a. gehören dazu die Lyrikbbände Colonia Fabricii/Kolonie der Fabrik, die 2015 erschienen ist. O lume din evantaie pe care să nu o împarți cu nimeni/Eine Welt von Fächern, die man mit niemandem teilen muss, Ale noastre, dintru ale noastre/Unseres, aus Unserem und mehrere Romane, darunter Al 4-ea/ Der Vierte, Brâncuși sau cum a învățat țestoasa să zboare/Brâncuși, oder wie die Schildkröte fliegen lernte. Ein Teil Deiner Gedichte wurde ins Französische übersetzt, aber ebenso, wenn ich richtig informiert bin, ins Deutsche, Englische, Schwedische, Spanische, Bulgarische, Ungarische, Litauische, Russische, Aserbaidschanische, Katalanische und Türkische.
Vielen Dank, dass Du Dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Heute werden wir über den Band Ofsaid sprechen, für den Du 2023 den Kulturpreis des Rumänischen Radios und den Preis der Zeitschrift Observatorul Cultural/ Der kulturelle Beobachter erhalten hast. Die deutsche Übersetzung von Alexandru Bulucz, Metallische Igel, steht auf der Liste der Lyrik-Empfehlungen 2025, das jährlich zusammengestellt wird. Ende März, also vor ein paar Tagen, warst Du auf der Leipziger Buchmesse. Lass uns doch mit den Erfahrungen in Leipzig beginnen.
Buchmesse, Austausch und ein anderes Publikum
MS: Ja. Zunächst einmal freue ich mich, hier bei Dir zu sein und dieses Gespräch zu führen. Für mich war es eine einmalige Erfahrung, denn ich war schon auf vielen Buchmessen … Ich war auf nationalen und internationalen Messen und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sich alle Buchmessen ähneln. Irgendwann tritt dann auch eine Müdigkeit ein, zumal die Leipziger Messe nach anderen Reisen folgte, und ich war sehr überrascht, angenehm überrascht. Mir schien sie die schönste Buchmesse zu sein, die ich je gesehen habe. Von der Organisation über die Art und Weise, wie die Hallen selbst gestaltet sind, diese Innengärten, die Art und Weise, wie jeder seinen Stand präsentierte, bis hin zu der Tatsache, dass es so viele Leute gab und so viele junge Leute und, nun ja, junge Leute in den, wie ich verstanden habe, für Leipzig traditionellen Manga-Kostümen. Aber auch die Tatsache, dass ich keine Veranstaltung an irgendeinem Stand, egal von welchem Land, ohne Publikum erlebt habe. Es war also immer Publikum bei allen Veranstaltungen. Es war also gänzlich unerwartet, weil man uns beigebracht hat, dass auf Buchmessen, vor allem bei kleineren oder ausländischen Ständen, nicht die gleiche Präsenz ist wie an den Ständen des Gastlandes.
ED: Von mir aus gesehen ist das ganz normal, wenn es um Publikum geht. Wie unterscheidet sich dieses Publikum von dem der Buchmessen, die Du kennst, die Du bis jetzt kanntest?
MS: Zum Beispiel, eben bei der Vorstellung des Bandes Metallische Igel, wo wir gerade am letzten Messetag mit Alexandru Bulucz zusammen waren, gab es eine Bühne, irgendwo einen speziellen Raum für Buchvorstellungen, und ich bin es gewohnt, dass Leute, die ein Buch vorstellen, mit ihrem eigenen Publikum kommen. Das sehe ich auf allen Messen. Sie beenden ihre Veranstaltung, das Publikum steht auf, geht, es kommt das Publikum für das nächste Buch. Das ist mir hier nicht aufgefallen. Hier habe ich beobachtet, dass mindestens 50 Prozent des Publikums konstant war, es ist von einer Veranstaltung zur nächsten geblieben.
Ein weiterer Aspekt, den ich für extrem wichtig hielt, war die Tatsache, dass bei jeder Veranstaltung, die ich sah, Leute aller Altersgruppen anwesend waren, und ich denke, dass dies alles, alles, sehr wichtig ist. Und ich weiß nicht, mir hat die ganze Leipziger Buchmesse sehr gut gefallen, sie hat mich beeindruckt.
ED: Wie ist das hiesige Publikum denn anders? Da Du alle Generationen so betont hast, welche Generation ist in Chișinău (vertreten)?
MS: Ich glaube, je nachdem, wer die Veranstaltung organisiert, weiß man schon die Zielgruppe. Es gibt immer Veranstaltungen, zu denen mehr ältere Leute kommen, dann gibt es zum Beispiel die Workshops von Dumitru Crudu, zu denen sehr viele Jugendliche gehen. Es gibt den Literaturkreis Republica, wo junge Leute hingehen. Irgendwie ist es sehr … Ich meine, wenn man einen bestimmten Schriftsteller oder eine bestimmte Person in der Öffentlichkeit treffen will, weiß man ziemlich genau, zu welcher Art von Veranstaltung man gehen kann, wo man ihn treffen könnte.
ED: Du hast Dumitru Crudu erwähnt. Wir werden wahrscheinlich über ihn sprechen, wenn wir über die Literaturszene in Chișinău zu sprechen kommen, von der ich das Glück hatte, gestern einen ersten Eindruck bekommen zu können und ich freue mich darauf, in den kommenden Tagen neue Eindrücke zu gewinnen. Aber bevor wir zu Chișinău kommen, wo wir gerade darüber sprechen, würde ich gern noch einmal auf die Erfahrungen in Leipzig zurückkommen. Was für Feedbacks hast Du zu deinem Buch erhalten? Wie wurde das Buch aufgenommen? Welchen Eindruck hattest Du?
Übersetzungen, das richtige Gefühl und der Sport in der Lyrik
MS: Ja… Ich glaube nicht, dass ich mir bis jetzt hätte vorstellen können, dass auf einer internationale Messe Organisatoren zu mir kommen und sagen: Ich habe Dein Buch noch nicht gelesen, aber ich will es lesen. Und das dank der Aufnahme des Buches auf die Empfehlungsliste. Und ich hatte sehr, sehr viel Glück. Jeder will immer übersetzt werden, und dann denkt man gar nicht mehr darüber nach … Das Wichtigste ist, dass eine Übersetzung erscheint. Aber wenn mich jemand gefragt hätte und wenn ich hätte wählen können … Ich habe mir immer gewünscht, dass besonders die Übersetzungen meiner Gedichte, nicht Gedichte im Allgemeinen, von Dichter:innen oder Schriftstellern:innen selbst gemacht werden. Und bisher hatte ich diese Chance, denn auch in Frankreich ist eine Anthologie erschienen, und ein Teil davon ist von der Dichterin Linda Maria Baros aus Schweden übersetzt worden. Der Band erschien in der Übertragung einer jungen Autorin von dort. Und schau… in Deutschland hatte ich diese besondere Chance, von Alexandru Bulucz übersetzt zu werden. Ich hatte noch keine Gelegenheit, ihn zu lesen, weil er ein deutschsprachiger Dichter ist, aber ich habe einige seiner Gedichte in Übertagung gelesen. Und es scheint mir, dass wir uns irgendwie im gleichen poetischen Universum treffen, sodass ich auch verstehen konnte, warum er dieses Buch ausgewählt hat. Er ist ein sehr guter Dichter und er arbeitet mit einer Art der Rückgewinnung von Räumen, die eine Zeit lang aus der Literatur ausgeschlossen waren, ich könnte etwa die Religion erwähnen, wo … , ja, wir uns sehr gut treffen. Es stimmt zwar, dass ich über Fußball schreibe und er über Basketball, aber wir sind nicht so weit voneinander entfernt. Und es geht ja schließlich um den Ball.
ED: Ja … , als ich mit Alexandru über Dein Buch sprach … Tatsächlich habe ich von Alexandru über das Buch erfahren. Ich habe mit Alexandru gesprochen, als er bei einer Präsentation war. Unsere Leserschaft der Spiegelungen kennt ihn als Dichter schon lange, seit mehreren Jahren. Und als er letztes Jahr bei einem Vortrag mit Georg Aescht in München war, wo wir über Übersetzungen und die Rolle des Übersetzers gesprochen haben … damals kannte ich Deinen Namen, aber ich hatte Deine Bücher nicht gelesen. Und dann hat er gesagt, er arbeite an etwas wirklich Gutem und das käme jetzt raus. Erst dann habe ich die Übersetzungen auf Deutsch gelesen und nachher Ofsaid auf Rumänisch. Also, ich hatte einen etwas anderen Weg: von der Übersetzung zum Original. Als ich mit Alexandru sprach, sagte er, dass das Übersetzen für ihn ein tief emotionaler Akt sei. Er übersetze Bücher, die zu ihm als Dichter und als lyrischem Ich passten. Nachdem ich das Buch gelesen hatte, wurde mir klar, dass Ihr Euch nicht nur in Puncto Sport und Glauben trefft, sondern auch in der Beschreibung des Lebens, des Alltags und im Ton. So wollte ich Dich fragen, wie Ihr an der Übersetzung gearbeitet habt? Ich habe mit Alexandru nicht im Detail über die Übertragungen an sich gesprochen. Habt Ihr Euch abgesprochen, hat er dich oft konsultiert oder wie sehr warst Du in den Übersetzungsprozess eingebunden?
MS: Ja … Nicht sehr viel. Klar, es gab und gibt Momente, in denen er bestimmte Dinge konkretisieren wollte, aber ich glaube, er hat den Text sehr gut verstanden. Ich hatte auch großes Vertrauen. Ich hatte keinen Augenblick Angst, gerade weil ich, noch bevor er mir sagte, dass er vorhatte, den ganzen Band zu übersetzen, bei einer seiner Lesungen war. Er hatte in der Zwischenzeit etwas davon für eine Zeitschrift in Deutschland übersetzt, ein paar Gedichte und einige neue dazu.
Wir scherzten sogar, weil ich ihm sagte, dass wir vielleicht … irgendwie von vor Jahrhunderten verwandt sein könnten, weil seine Großmutter den gleichen Familiennamen wie meine hat. Und als ich ihn fragte, woher er komme, ich wusste, dass er aus Karlsburg/Alba Iulia stammte. Eigentlich kam seine Großmutter aus Eisenmarkt/Hunedoara und wir kamen uns immer näher. Meine Eltern erzählten mir, dass wir auch sehr alte Verwandte irgendwo in Hunedoara hätten. Und ich dachte, es wäre schön, in einem zukünftigen ewigen Leben zu erfahren, dass wir beide unser literarisches Talent von demselben Ururgroßvater oder der gleichen Großmutter geerbt hätten. Natürlich sage ich das so … ich sage es, weil ich es wirklich für sehr wichtig halte, sich selbst wiederzufinden. Ich habe nie übersetzt, ich bin keine Übersetzerin. Aber ich sehe dasselbe beim Lesen von Büchern. Ich kann Bücher lesen, von denen ich ganz genau weiß, dass sie sehr gut sind, die mich aber nicht berühren. Und ich bin begeistert von den Büchern, in denen ich mich wiederfinde, wo ich das Gefühl habe, dass der Autor die Dinge genauso empfindet wie ich. Und ja, ich glaube, das spielt eine sehr große Rolle, und es machte viel bei der Veröffentlichung des Bandes Metallische Igel aus.
Wie ein neuer Titel zustande kommt
ED: Der deutsche Titel hat mir sehr gut gefallen und ich wollte darüber auch mit Dir reden. Wie gefällt Dir Metallische Igel auf Deutsch?
MS: Ja, er gefällt mir sehr gut! Der Titel war der Vorschlag des Verlags, er schlug vor, einen Titel aus dem zweiten Teil des Buches zu wählen, der mehr darüber erzählt, was in der Ukraine geschieht, und es ist ein Satz, den ich in einem Gedicht über Odessa verwendet habe, wohin ich mit meinem Mann, Alexander Vakulovski, jedes Jahr an meinem Geburtstag fuhr. Und gleich nach Beginn des Krieges gab es diese Bilder von diesen Metall-Igeln, die platziert wurden, um die Panzer aufzuhalten. Mir gefiel die Idee, den Titel zu ändern. Ich weiß, dass es einigen AutorInnen seltsam vorkommen mag, und wenn ich Ofsaid hätte beibehalten wollen, hätte ich es wahrscheinlich auch tun können, … aber von Anfang an, als Alexandru mit einigen Vorschlägen kam, darunter dieser Metallische Igel, gefiel er mir sehr gut und ich sagte: Ja, das nehmen wir. Also, auch wenn der Ausdruck aus dem Buch stammt, es ist sein Vorschlag.
ED: Mir gefielen die Metallischen Igel sehr, weil ich das lyrische Ich in diesen Gedichten irgendwie als Metallische Igel sehe. Also mit einem Kern, sozusagen, mit einer ganz weichen inneren Schicht, mit vielen Gefühlen, aber von außen hin metallisch zugedeckt. Nachdem ich das Buch auf Rumänisch gelesen hatte, schien mir der deutsche Titel, ehrlich gesagt, passender.
MS: Es gibt eine Sache …, ich habe Alexandru nie danach gefragt …, weil ich auch ein anderes Buch hatte, aber es wurde im Charmides Verlag veröffentlicht, und es war nicht sehr präsent. Darin gibt es ein sehr umfassendes Gedicht über Igel, in dem ich mich bzw. das lyrische Ich mit dem Igel identifizierte. Ich erinnere mich, ich weiß das Gedicht nicht mehr auswendig, aber es beginnt mit „Igel stehen im Zeichen des Glücks“ und ich glaube, dieses Gedicht hat mich dazu gebracht, dass ich mich mit diesem Titel sehr wohl fühle. Und ich denke, ja, ich glaube, Du liegst sehr richtig, dass das eigentlich das Thema des ganzen Buches ist. Schließlich sind Igel so liebenswert, wenn sie sich nicht zur Kugel rollen. Und eine Metallkugel könnte sehr viel verändern.
Dreiklang in der Poesie und die Kraftquellen
ED: Du hast jetzt den zweiten Teil erwähnt, aber ich würde noch ein wenig über diesen Dreiklang sprechen: die Mischung von Orthodoxie, Fußball und Poesie. Ich finde das eine sehr spannende, ungewöhnliche Kombination, vor allem wenn man bedenkt, dass eine Frau über ein Thema schreibt: Fußball, das eher als Männerthema gilt.
MS: Der Krieg ist schließlich auch etwas für Männer.
ED: Aber wenn ich an die Zeile eines Gedichtes denke, in dem es heißt „das Leben kann dich unvorbereitet erwischen“ und dann folgt ein Vergleich mit Boatengs Sprung … Oder an die Zeile über einen Rumänen, der immer in der zweiten Liga gelistet wird … Dann wird mir klar, dass solche scheinbar überraschenden und divergierenden Assoziationen eigentlich die Banalität des Alltags entlarven. Und was mir an dem Buch besonders gefällt, ist die Ironie. Manchmal ist sie subtiler, manchmal gar nicht, was eine Kombination aus Ironie und einer Art von Härte ergibt. Und dieses lyrische Ich steht nach schwierigen Situationen auf und macht weiter, sogar nach „einem Muskelriss, sechs gebrochenen Zähnen“, wie Du schreibst.
MS: Der Muskelriss war von Manuel Neuer. Er spielte ein Halbfinale gegen Barcelona und hatte einen Muskelfaserriss, blieb aber bis zum Ende des Spiels auf dem Platz.
ED: Und ich dachte darüber nach, dass in der ganzen Situation und im zweiten Teil … Wie siehst Du es, was ist die Quelle für eine solche Kraft, die man aufbringt? Wenn man einen Krieg hat, wenn man Fußball spielt, welche Kraftquellen hat man? Woher nimmt man die Kraft? Wenn man weiter geht, wenn das lyrische Ich auch weiter geht, obwohl es eigentlich keine Kraft mehr hätte?
MS: Ja, das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich glaube, ich sollte zuerst sagen, dass der erste Teil in acht Jahren geschrieben wurde. Es war ein ehrgeiziges Projekt, Gedichte über Fußball zu schreiben, das auch als eine ironische Reaktion auf die vielen schlechten Liebesgedichte, die überall auf der Welt geschrieben werden, begonnen hatte. Und ich dachte mir, ich schreibe Gedichte über Fußball, schreibe leidenschaftlich. Wie Du sicher bemerkt hast, tauchten die Probleme mit der russischen Politik, die in diesem Teil Europas sehr aggressiv vorangetrieben wird, schon im allerersten Gedicht von 2014 auf, denn das war die Situation damals. Ich wollte, dass das sichtbarste Thema nicht unbedingt der Fußball selbst ist, denn ich beschreibe nicht unbedingt die Spiele … Wie Du schon gesagt, bemerkt hast, es ist ein Vergleich mit dem Fußball, um Situationen aus dem wahren Leben zu veranschaulichen. Denn eigentlich, hat man uns seit der Antike nicht gesagt, dass das Leben ein Spiel ist, eine Bühne ist? … Wenn man es so will. Oder es ist ein Stadion. Und die Tatsache, dass ich einen Witz, ein scheinbar nicht ernstes Thema ‒ Fußball ‒ ansprach, versetzte mich in die Lage, über Dinge zu sprechen, die leicht in einen pathetischen Bereich fallen könnten, in den ich nicht eindringen möchte, … wie es vor allem mein Glaube an Gott, aber auch das Fehlen von Mutterschaft in meinem Leben wären. Und dann konnte ich diese Dinge in einem spielerischen Ton, in einem scherzhaften Ton machen. Wir haben in der rumänischen Literatur ‒ ich beziehe mich in erster Linie auf die rumänische Literatur ‒, weil ich sie besser kenne, aber ich denke, es ist überall auf der Welt gleich. In der Lyrik finden wir noch Humor, aber sehr selten bei Dichterinnen, üblicher ist es bei Dichtern. Und irgendwie ist es das, was ich mit diesem Buch erreichen wollte, aber an einem bestimmten Punkt konnte ich das Buch nicht mehr beenden. Alle fragten mich: „Was machst du denn damit?“ Die Gedichte waren in Zeitschriften erschienen, irgendwo in Schweden … ich weiß nicht wo, in England. Das Buch veröffentlichte ich aber nicht und sagte immer wieder, dass der rumänische Fußball zu schlecht laufe und man sehe, die Deutschen würden auch keine Pokale mehr gewinnen. Ich bin ein großer Anhänger der deutschen Fußballnationalmannschaft, obwohl ich dieses Interview dazu nutze, zu sagen, dass ich alle deutschen Schiedsrichter zutiefst hasse, wenn eine rumänische Mannschaft spielt. Mit einem deutschen Schiedsrichter weiß ich ganz genau, dass es einen nicht gewährten Elfmeter oder eine rote Karte für irgendetwas geben wird. So, diese Unterscheidung will ich machen … Und irgendwann habe ich mich mit diesem Projekt für die Cărturești-Stipendien beworben. Ich sagte, wenn ich nicht gehe, wenn ich nicht irgendwo einen Monat bleibe, werde ich das Buch nicht fertigstellen können, und die Idee war, auf Dichter, auf ältere Fußballer zurückzugreifen. Ich wollte umfassendere Teile über die goldene Generation des rumänischen Fußballs haben. Ich wollte einige vergleichende Gedichte von Neuer und Kahn und so weiter … machen. Und ich bekam dieses Stipendium tatsächlich, im März 2022, eine Woche vorher begann der Krieg. Ich kam dort an, und dachte, dass Literatur im Allgemeinen keinen Sinn macht. Mir tat es leid für den wunderbaren Raum, in dem ich mich befand, weil ich mich nicht zum Schreiben zusammenreißen konnte. Und eigentlich wurde der zweite Teil, der wie der erste aus 33 Gedichten besteht, in einem Monat in Câmpulung Mușcel geschrieben. In dem Moment, als ich verstand, dass das Einzige, was ich noch schreiben konnte, das war, was ich damals empfand. Und dann fühlte ich, dass es wichtig ist, dass wir auch in der Kunst versuchen, uns mit der Ukraine zu solidarisieren. Da ich in Chișinău lebe, war die Wirkung natürlich noch stärker. Als wir zu dieser Residenz fuhren, nahmen wir praktisch alle unseren Papieren mit uns nach Rumänien nach Câmpulung Mușcel, in eine alte Villa, ein historisches Haus mit einem dendrologischen Park auf drei Ebenen. Es war wunderschön, aber wir kamen dort an und konnten uns nicht freuen. Es war ein unglaublicher Widerspruch. Nachts hörte man Flugzeuge über uns kreisen. Es war sehr merkwürdig. Und wir hatten sogar die Wohnungspapiere mitgenommen, unsere Universitätszeugnisse und alles, ohne zu wissen, ob wir nach Chișinău zurückkehren werden. So wählte ich diese Form des Reportage-Tagebuchs, irgendwo zwischen Tagebuch und Reportage, in dem ich mich genau das sagen ließ, was ich fühlte. Dann habe ich mit Svetlana Cârstean gesprochen, ich habe das Buch bei Nemira in ihrer Lyriksammlung veröffentlicht, und ich erinnere mich, dass ich ihr damals gesagt habe, dass ich dieses Buch nie veröffentlichen werde, wenn ich es nicht diesen Sommer publizieren würde. Aber irgendwo war da eine Hoffnung in mir, ich habe oft darüber nachgedacht, warum ich mich gezwungen habe und nicht weitergearbeitet habe. Wenn ich jetzt zurückblicke, hätte ich vielleicht einige Dinge geändert. Ich glaube, ich habe gehofft, dass der Krieg noch in dem Jahr zu Ende gehen würde. Ich glaube, das habe ich mir sehr gewünscht.
ED: Wir alle hofften und dachten, es könne nicht länger als ein paar Monate dauern. Ich habe daran auch sehr geglaubt.
MS: Aber am Ende sollten wir froh sein, dass es gedauert hat, denn es ist noch nicht vorbei. Ich glaube, wenn es geendet wäre, hätten nur die Russen gewinnen können. Und die Tatsache, dass sich die Ukraine widersetzte … Ich weiß noch, wie ich nachts aufgewacht bin und immer wieder die Nachrichtenseiten nachgeschaut habe. Darf ich nun etwas Politisches sagen oder nicht?
ED: Ja, klar.
MS: Ich habe mich auch wie JD Vance in sozialen Netzwerken informiert. Und ich lebte im ständigen Stress, weil ich nicht sagen konnte … Ich hatte Freunde aus der Ukraine, ich kannte Ukrainer, ich kannte Rumänen aus der Ukraine, ich hatte Freunde in der Gegend von Czernowitz. Alles änderte sich damals und die Tatsache, dass wir einen Lieblingsort hatten, an den wir in der Ukraine ans Meer fuhren, und unsere Ausflüge nach Odessa … Und plötzlich dachte ich: Wenn ich mich der Freude beraubt fühle, wenn ich so leide, wie müssen sich dann diejenigen fühlen, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Es war ein harter Moment und ein Moment, der mir wieder einmal bestätigte, dass gerade die Poesie eine Form des sozialen Widerstands ist. Das war sie schon immer.
Poesie als sozialer Widerstand ‒ Dichter:innen als Antikörper der Gesellschaft
ED: Du hast gesagt, Du hattest damals das Gefühl, die Literatur würde keinen Sinn mehr machen. Und jetzt sagtest Du, wenn ich Dich richtig verstehe, dass Du jetzt eine Perspektive hast. Du hast einen Sinn gefunden, eine neue Perspektive. Und wie sieht diese gesellschaftliche Rolle der Literatur aus heutiger Sicht aus? Wir sprechen jetzt mehr als drei Jahre später. Der Krieg geht weiter, mal sehen, bis wann und wie. Wo hast Du Dir Deine Perspektive gefunden? Wie siehst Du Deine Rolle als Autorin jetzt? In Chișinău … wir reden nicht irgendwo, wir reden in Chişinău. Wir sind näher an Odessa als an Cluj oder Timișoara.
MS: Als an Iași. Und zumindest dort, wo meine Schwiegermutter wohnt, sind es nur 20 Kilometer bis zur ukrainischen Grenze. Nach Odessa sind es 60 Kilometer Luftlinie, also noch näher.
ED: Wie siehst Du die Rolle in der aktuellen Situation? Worin besteht diese soziale Rolle?
MS: Ich glaube, zunächst einmal erschien mir damals alles sinnlos, denn in dem Anschreiben, das ich für die Bewerbung um die Cărturești-Stipendien abgeben musste, schrieb ich: „Ich möchte mein Fußball-Poesie-Projekt abschließen.“ Ich habe dieses Anschreiben nicht sehr ernst genommen. Ich glaube, ich habe nicht einmal erwartet, zu gewinnen. Ich erinnere mich, dass ich auch gesagt habe, dass ich Zeit brauche, um mir auf YouTube die Aufzeichnungen von alten Spielen anzusehen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich diese Residenz bekommen würde. Ich bin sehr froh, dass ich sie bekommen habe, denn sie bedeutet mir und diesem Buch sehr viel, das schließlich ein gutes Schicksal hat. Aber als ich da ankam: Welches Fußball-Gedicht? Am liebsten wäre ich auf Fußballspieler losgegangen. Welcher Fußball? Da brauchte ich nichts mehr. Aber ich dachte immer wieder an Ion Mureșan, einen unserer großen Dichter, der sagte, Dichter:innen seien die Antikörper der Gesellschaft. Und je größer die Krise in der Gesellschaft, desto größer die Zahl der Dichter:innen. Genau wie bei den Antikörpern, es tauchen immer mehr Dichter:innen auf. Und wenn man sich die frühesten Formen ansieht, ich weiß nicht, ich denke jetzt an den Fall von Troja. Das war das Thema des frühesten Gedichts, das wir in der europäischen Kultur haben. Dann, ja, du verstehst, dass die Literatur, auch wenn sie zur Fiktion wird, auch wenn sie ein Roman ist, gewisse Zustände besser dokumentiert als die Geschichte. Und ich überlege jetzt und denke über den Ersten Weltkrieg nach und über alles, was ich über den Ersten Weltkrieg gelesen habe: Nichts hat mich so beeindruckt, schockiert und berührt wie die Bücher von Ernst Jünger. Denn er sagt dort auch, ich erinnere mich an eine Situation, als seine Vorgesetzten ihn für eine bestimmte Haltung kritisieren und er sagt: „Ich habe sie zutiefst verachtet, weil sie nicht verstehen, dass es in den Schützengräben kein rechts, links, oben, unten gibt.“ Und er beschreibt das alles so eindringlich, so gut verständlich. Und es gibt da eine Szene, In Stahlgewitter, als er fast tot ist, am Straßenrand liegt, und diese Kieselsteine auf dem Bürgersteig sieht. Und zum ersten Mal in dem Buch spricht er, weil ich es auch so mit der Religion habe, über die Vorfreude auf die Ewigkeit, die Vorahnung einer Ewigkeit, und man merkt, dass er die Sinnlosigkeit von allem um ihn herum und von allem, was im menschlichen Leben geschieht, spürt. Und plötzlich erscheint ihm alles, selbst der Krieg, so klein im Vergleich zu der Ewigkeit, die er irgendwie transzendental erfasst. Und in all dem Elend dort, in all dem Wahnsinn, in all den verrottenden Leichen, hört man die Geräusche, die von den Gasen erzeugt werden, da spürst du plötzlich, vielleicht zum ersten Mal im Leben, denn er spricht nie vom Glauben, Gott. Und irgendwie ist mir klar, dass die Geschichte all diese Dinge nie bieten wird. … Ja, ich denke, es ist die Rolle der Literatur, nicht nur als Flucht …, ich denke, es reicht, sich Tolkien anzuschauen und zu wissen, dass sogar er die Wirklichkeit benutzt hat, sogar er hat seine eigenen Erfahrungen benutzt. Alles, was man in ein Buch packt, egal wie fantastisch die Welt, die man erschafft, zu sein scheint, kommt aus der Realität, die man erlebt hat.
Der Glaube, mit dem man auf die Welt kommt
ED: Und die Realität, die man erlebt, ist auch der Glaube. Der Glaube ist also nicht nur ein sehr, sehr wichtiges Thema in Deinen anderen Büchern, sondern auch in Ofsaid. Aber dieser Glaube … Du hast in einem Interview gesagt, dass Du mit dem Glauben geboren wurdest. Ja, … dies hat mich sehr beschäftigt, seit ich dieses Gespräch gelesen habe, und ich habe darüber nachgedacht, wie man denn mit dem Glauben geboren wird. Es scheint mir, wie soll ich sagen, ein Geschenk zu sein, ein enormes Geschenk, sagen zu können: „Ich wurde mit dem Glauben geboren“. Für mich ist der Glaube etwas, mit dem ich kämpfe, auch das ist ein Glaube, aber ich habe sozusagen einen kämpferischen Glauben. Es ist also nicht etwas, womit ich geboren wurde, dieses Gefühl habe ich nicht. Ich finde das sehr interessant, und dieses Gefühl des Glaubens ist sehr grundlegend für Deine Poesie, das stehtfest. Es taucht in vielen, vielen Zeilen auf, wobei es eine Zeile gibt, die mir besonders gefallen hat. Darin heißt es, dass die Narren glücklich seien, sagt Sandu im Gedicht an einer Stelle und das lyrische Ich fügt hinzu: „und die Gläubigen“. Und ich dachte, ups…, das ist der Vorwurf, den ich den Gläubigen gelegentlich mache. Und ich musste sehr viel darüber nachdenken. Kannst Du über den Glauben sprechen, mit dem man geboren wird, wie ist er?
MS: Ja, ich denke, der erste große Vorteil, den mir meine Geburt als Gläubige gebracht hat, ist, dass ich nie über Ungläubige geurteilt habe. Gut, es gibt auch Menschen, die nicht für den Glauben kämpfen, die stolz darauf sind, dass sie nicht glauben, und sie vertreten die Ansicht, die Gläubigen seien schwache Menschen oder naive Menschen oder dumme Menschen, um es richtig auszudrücken, und irgendwie habe ich diese Einstellung nie verachtet, weil ich erkannt habe, dass ich, wie Du sagtest, mit einem großen Geschenk daherkomme. Dass ich mit dem Glauben geboren wurde, erkannte ich, weil ich zurückdachte und es nie eine Zeit gab, in der ich nicht geglaubt hätte. Ich hatte, vor allem als Erwachsene, Augenblicke des Zweifels, denn das ist ganz selbstverständlich, ich meine, deshalb heißt es ja auch „Glaube“ und nicht „Überzeugung“. Ich hatte Momente des Zweifels, aber seitdem meiner Geburt, seitdem ich mich erinnern kann … Ich wurde nicht in eine gläubige Familie hineingeboren, kann auch nicht sagen, dass meine Eltern es mir mit Zwang in den Kopf gesetzt hätten.
Meine Eltern glaubten, vermute ich, irgendwie, aber auf ihre eigene Art und Weise. In unserem Dorf wurde die Kirche im Kommunismus geschlossen. Und dennoch erinnere ich mich, dass im Haus einige Ikonen herumstanden, und ich weiß noch, wie ich einen Stuhl aufstellte, um mit den Ikonen wie der Pope herumziehen zu können. Dies bereitete mir viel Freude. Ich betete für Schnee, ich betete für Sonnenschein, um ins Bad zu gehen. Ich hatte in meiner ganzen Kindheit eine sehr persönliche Beziehung zu Jesus. Ich stellte ihn mir vor, als ich schlecht träumte. Ich ging nicht zu meiner Mutter, um sie zu wecken, ich stellte mir Jesus oder den Schutzengel vor, der doppelt so weit entfernt auf der Bettkante saß. Und es hat mir anscheinend auch deswegen den Vers gebracht, in dem Sandu sagt, dass nur Narren immer glücklich seien, und ich sage ihm: „oder die Gläubigen“, weil der Glaube einem diese Kraft gibt, nicht weil man nicht in unglückliche Situationen gerät. Ich habe gerade über die Situation in der Ukraine gesprochen, die mich sehr mitgenommen hat, und ich denke, dass sie jemanden, die oder der Schriftsteller:in oder Künstler:in werden will, umso mehr berührt, weil Kunst im Allgemeinen das Ergebnis von Empathie ist, sozusagen von tiefer Empathie, und dann berühren einen bestimmte Situationen viel mehr. Aber ich bin überzeugt, dass es eine Reise ist, es ist ein Test, eine harte Prüfung. Man geht auf die Universität, man hat auf jeden Fall ein Fach, man weiß, dass man irgendwann diese Prüfung abgelegt, bestanden, weitergemacht hat und setzt sein Leben fort. Und irgendwie verleiht einem die Überzeugung, dass das, was hier passiert, nicht alles ist, die Fähigkeit zu einem gewissen Stoizismus, um angesichts all des Unglücks, das kommt, bestehen zu können und alle Hoffnung in einen Glauben zu setzen oder vielmehr in den Gegenstand des Glaubens, in Gott. Ungefähr so sieht es mit dem Glauben aus, und als ich jung war, fiel es mir viel schwerer, gläubig zu sein.
Denn mir schien es vor allem, dass man nicht alles machen kann, was man will, man musste … dass ich nicht immer Lust hatte, in die Kirche zu gehen, dass ich nicht immer Lust hatte, zu fasten, dass ich nicht immer Lust hatte, nicht zu wissen … Oder vielleicht hätte ich manchmal einen Blödsinn gemacht, der mir mit meinem Glauben nicht vereinbar zu sein schien. Aber nachdem ich die 40 überschritten habe, wird mir klar, dass es nicht … Es gibt weiterhin ein großes Aber und eine große Ruhe, die einen sehr stärkt, wenn man anfängt zu begreifen, dass man, ich weiß nicht, sich einer globalen Katastrophe nähert oder dem Altern oder dem Tod näherkommt. Irgendwie schafft man es, mit all diesen Dingen Frieden zu schließen, und man schafft es, mit all den Dingen Frieden zu schließen, die im Leben nicht geschehen und von denen man aber wünschen würde, dass sie passieren.
Humor und Schicksal
ED: Und dieser Glaube ist sehr gut mit dem Humor vereinbar, der mir in diesem Buch ebenso sehr gut gefällt. Es gibt etliche Gedichte, die ich mehrmals las, in denen ich diese Kombination von Humor und Glauben sehe. Es gibt einige Zeilen, die ich zitiere, da heißt es: „Die Überlegenheit des Intellektuellen, der vom Fußball /angewidert ist, wäre / von Gott aus sichtbar, würde Er Bilder entwickeln / von der göttlichen Tribüne“. Als ich diese Zeile zum ersten Mal las, gefiel sie mir so gut, dass ich sie aufschrieb und meinem Mann sagte, dies sei für mich der außergewöhnliche Humor, der die Hauptthemen des Buches verbindet. Und ich mag sehr gerne Zeilen, mit denen ich ein paar Tage lang leben kann. Ich gehe also irgendwo in Chişinău herum, oder wo immer ich bin, und erinnere mich an einige Verse. Und das waren zum Beispiel solche Zeilen, bei denen ich wirklich dachte: Wie gut die Themen des Krieges in der Ukraine, die Unmöglichkeit, Mutter zu werden, mit dem Glauben und Fußball Hand in Hand gehen!
Wie siehst Du die Rolle des Humors in dem Buch? In meinen Augen ist er etwas sehr Zentrales und Grundlegendes.
MS: Ja, das erinnert mich an eine Phase. Es war während der Wahlen in Rumänien, als die Hauptkandidaten Klaus Johannis und Ponta waren. Irgendwo in Siebenbürgen teilten sie eine Art von Ikonen mit dem armen Arsenie Boca aus. Ich sage „arm“, weil auf der Rückseite „gesegnet“ und noch dazu „wählt PSD“ (Sozialdemokratische Partei) stand. Und dies jagte mir Angst ein. Diese Momente sind sehr schmerzhaft für mich, denn ich weiß, wenn man Arsenie Boca fragen würde, wäre er mit so etwas nicht einverstanden. Wir hatten mit einigen Freunden aus dem theologischen Bereich gescherzt, dass Gott einen Sinn für Humor hat. Aber als Ponta die Wahl verlor, sagten wir: Ah, wie gut, dass Arsenie Boca keinen Sinn für Humor hat! Denn schau, er hat den Witz nicht genossen. Also, irgendwie scheint es mir, dass sie sich verbinden, sie verbinden sich auf eine klare Art und Weise, und deshalb habe ich auch dieses Bild, das Du sehr gut erfasst hast, benutzt und wollte es so kombinieren, weil es eine ganze Überzeugung von mir erfasst. Auf der einen Seite der Eindruck, von dem ich sprach, dass viele Menschen den Eindruck haben, man müsse naiv, um nicht zu sagen dumm sein, um gläubig zu werden. Dazu kommt die Verachtung vieler Intellektueller für Microbisten, sagen wir, oder Fußballer: „Na schau hin, so wird man Millionär, wenn man einem Ball hinterherjagt, aber wie hart arbeiten und schuften die Intellektuellen!“ Aber ich überlege dann immer, und ich sage das nicht ironisch: Wir Intellektuelle arbeiten nicht so hart wie ein Sportler, zumindest nicht in den ersten 35 Jahren unseres Lebens. Also, nicht nur körperlich. Wir haben nicht so viel… Wir können es uns jederzeit leisten, eine dreitägige Pause zu machen. Wir können es uns immer leisten, morgens länger zu schlafen, wenn ich eine Lesepause einlegen oder einen schlechten Film sehen möchte. Oder wir haben eine gewisse Freiheit, die ein Sportler nicht haben kann. Er lebt seine ganze Jugend und vor allem seine ganze Kindheit in einem spartanischen Regime. Und dann glaube ich, dass diese Verachtung für den Sport oder für Menschen, die sich für den Sport begeistern, nicht wirklich begründet ist, denn … und deshalb wird Manuel Neuer in dem Buch so oft erwähnt, weil er ein Beispiel ist, das, wenn man es auf einen anderen Bereich überträgt, zu einem Modell für jeden wird. Ich würde gerne ein so guter Dichter sein, wie Manuel Neuer ein guter Torwart ist. Ich wünsche und ich habe diesen Vergleich zwischen der Prosa Dostojewskijs und dem, was Manuel Neuer tut, gemacht. Oder ich habe ein anderes Gedicht, in dem ich darüber spreche, was nicht geschehen wäre, wenn Manuel sich entschieden hätte, etwas anderes im Leben zu machen. Ich meine, es gibt einige Dinge … und die Tatsache, dass ich es für extrem wichtig halte, habe ich in diesem Buch aufgegriffen: Wir bekommen von absolut allem, was uns umgibt, sehr gute Lektionen fürs Leben, und es geht nur darum, zu wissen, wie man sie überlappen und kombinieren kann. Wie man den Glauben mit dem Sport, und mit allem verbindet, was uns definiert.
Die Literaturszene in Chişinău
ED: Das ist eine sehr seltene Fähigkeit, scheinbar divergierende Dinge miteinander zu verbinden und sie so zu konstruieren, dass sie in einer Fiktion oder in einem Gedicht etwas „Ganzes“ ergeben, also etwas, eine Einheit, die in diesem Buch sehr gut verwirklicht wird. Aber wenn wir schon über die Wirklichkeit sprechen, dann lass uns doch auch ein wenig über die Realität sprechen, in der Du hier jeden Tag lebst und in der Du gesagt hast, welche Rolle die Literatur für Dich spielt.
Als ich angekommen bin, bin ich zu Dumitru Crudu gegangen und er sagte, er habe eine Buchpräsentation. Ich bin dann mitgegangen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich noch nicht einmal 24 Stunden in Chişinău bin und in der Literaturszene so viel passiert: Buchpräsentationen, literarische Begegnungen. Du zählst mit Alexandru Vakulovski zu den sehr agilen Akteuren in dieser Szene. Kannst Du etwas über diese Literaturszene und Eure Rolle darin sagen?
MS: Ich glaube, wir versuchen alle, aktiv zu sein, und nicht nur in der Literaturszene. Ich habe gerade daran gedacht, als Du sagtest, wie viele Veranstaltungen stattfinden, dass ich am Dienstag, da Du sagtest, Du würdest am 8. abreisen, … mit Bedauern dachte ich, wie schade, dass Du nicht bis zum 9. bleibst.
Im Kunstmuseum findet die erste Einzelausstellung von Silviu Oravitzan statt. Ich denke, er ist ein großer Maler, nicht nur rumänischer und nicht nur zeitgenössischer. Und ich glaube, ich bin gerade in einem Zustand, in dem ich versuche, herumzutelefonieren und … ich hoffe, dass viele Leute die Bedeutung dieser Ausstellung erkennen. Auf der anderen Seite gibt es morgen den Workshop von Dumitru Crudu. Das wird sehr schön werden! Wir sind in der Bibliothek praktisch Kollegen, und viele der jungen Dichter:innen um Dumitru Crudu debütieren später in dem Verlag, in dem ich arbeite, in der Debüt-Sammlung Pulsar, die ich zusammen mit Augustina Vișan, einer sehr guten Dichterin, die zufällig auch die Nichte von Dumitru Crudu ist, ins Leben gerufen habe. Literarisches Talent wird auch vererbt. Seit einigen Jahren gibt es wichtige Festivals, und Ende August kommt das Bookfest aus Rumänien nach Chişinău. Unser Literaturkreis ist so etwas wie ein Vermittler, wenn Dumitru Crudu die fantastische Energie hat, mit jedem jungen Literaturbegeisterten bei null anzufangen, diskutieren wir im Literaturkreis bereits mit Dichter:innen, oder Prosaautor:innen, die bereits im Werden sind. Manchmal begeben wir uns sogar außerhalb der Literatur. Es gab auch Veranstaltungen mit einem bildenden Künstler, Ghenadie Popescu, oder ich erinnere mich, dass wir einen großen bessarabischen Filmregisseur, Victor Bucătaru, hatten. Gerade in den letzten Jahren seines Lebens gelang es uns, eine Veranstaltung mit ihm im Literaturkreis Republica zu machen, und wir sprechen hier über Deutschland … Einmal hatten wir auch den Fotografen Dirk Skiba zu Gast, der über sein Projekt mit Schriftsteller:innen sprach. Wir bewegen uns also in verschiedenen Bereichen, aber als wir den Literaturkreis Republica gründeten, ging es uns in erster Linie darum, echte Brücken zwischen jungen Schriftsteller:innen aus Rumänien und jungen Schriftsteller:innen hier zu bauen. Ich glaube, wir hatten in den 14 Jahren unserer Tätigkeit bereits über 100 Gäste, aber auch, um den jungen Dichter:innen ein echtes Feedback zu geben, bevor sie ihr erstes, zweites oder drittes Buch veröffentlichen. Ich glaube, wir machen in unserer Gruppe so ziemlich alle eine Lesung im Literaturkreis Republica, bevor wir ein Buch in den Druck geben. Und dies, weil ein Literaturkreis einen nicht unbedingt besser macht, aber einem hilft, einige Etappen zu überspringen, er hilft einem, einige Dinge zu bemerken, die man in der Einsamkeit langsamer oder erst nach längerer Zeit sieht.
ED: Ich hätte noch ein paar Fragen und Ideen bezüglich des Literaturkreises und, ob Ihr auch Gäste aus Deutschland habt und wie dieser Dialog funktioniert. Aber das führt schon in eine andere Richtung. Also bedanke ich mich für Deine Zeit und ich hoffe, dass wir die Gelegenheit haben werden, über mögliche Kooperationen zwischen Deutschland und Chişinău zu sprechen. Ich danke für Deine Zeit!
MS: Vielen Dank auch meinerseits für die Einladung, es war sehr angenehm. Ich habe sogar vergessen, dass wir aufgezeichnet werden, ich hatte das Gefühl, ein nettes Gespräch mit Dir zu haben. Danke!
Die Übersetzung der Gedichte ‒ Gespräch mit Alexandru Bulucz
ED: Lieber Alexadru, danke, dass wir kurz über die Übersetzung von Moni Stănilăs Lyrikband Ofsaid/Metallische Igel sprechen können. Du bist in Deutschland vor allem als Lyriker, Literaturkritiker und Herausgeber bekannt, sodass ich es nicht unerwähnt lassen kann, dass Du 2016 als Lyriker debütiert hast und seitdem mehrere Preise und Förderstipendien erhalten hast. 2022 wurdest Du in Klagenfurt im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur mit dem Deutschlandfunk-Preis ausgezeichnet und erhieltest auch den bekannten Hölty-Preis sowie den Horst Bingel-Preis für Literatur. Aus dem Rumänischen hast Du unter anderem Alexandru Vona, Eugène Ionesco und Andra Rotaru, oder eben Moni Stănilă übersetz.
Bevor wir zur Moni Stănilăs Übersetzungsband sprechen, würde ich darauf zurückkommen, was Du letztes Jahr im November in München bei einem Gespräch gesagt hast, an dem Du zusammen mit Georg Aescht teilgenommen hast. Da ging es um Übersetzungen aus dem Rumänischen. Damals hast Du erörtert, dass Übersetzungen für Dich eigentlich Herzensprojekte sind und keine Auftragsarbeiten, wie das sonst oft bei literarischen Übersetzungen der Fall ist. Mich würde jetzt an unser Gespräch von damals anknüpfend interessieren, wie es dazu kam, dass Du solche Herzensprojekte angefangen hast.
AB: Ja, vielen Dank zuerst für die Einladung zu diesem Podcast-Format. Ich kenne das Format. Ich habe, glaube ich inzwischen mehrere Folgen davon mitbekommen, gerade in Social Media, was ja sehr wichtig ist für die Verbreitung solche Formate.
Der Weg zum Übersetzer
Aber direkt zur Frage: Es dürfte im Studium gewesen sein, also um 2010 in Frankfurt am Main, als ich Komparatistik und Germanistik studierte, dass ich anfing zu übersetzen. Es waren verstreute Gedichte, die ich mir vorgenommen hatte, nichts Systematisches oder dergleichen. Ganz konkret war es ein Gedicht von Ion Minulescu, das habe ich dann einfach für mich übersetzt. Wir hatten eine Zeitschrift in Frankfurt, eine Studentenzeitschrift, und da hatte ich mit dem Gedanken gespielt, es dort zu veröffentlichen, wozu es aber dann nicht kam. Also so fing es an.
Es war eine Art Strategie, auch mein Rumänisch wieder aufzufrischen, weil ich jahrelang davor im Grunde darauf bedacht war, mein Rumänisch zu vergessen, um mehr Platz zu haben für die neue Sprache, für das Deutsch. Ich bin kein bilingualer Autor. Ich kam nach Deutschland, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Und bald ging es dann in diese erste große Übersetzung von Alexandru Vona, die auch veröffentlicht wurde. Das waren verstreute Texte und irgendwann kam Andra Rotaru, Eugène Ionesco, jetzt eben Moni Stănilă, und auch verstreute Übersetzungen für Zeitschriften in Deutschland und Österreich vor allem. Ja, es sind Herzensprojekte, weil ich das einfach nebenbei mache. Das ist nicht mein Beruf. Ich erhalte mich finanziell damit nicht, sondern sobald ich Zeit habe, sobald mich etwas auch irgendwie persönlich angeht aufgrund der Thematik oder der Poetik der zu übersetzenden Gedichte, mache ich das. Und so war das im Grunde mit Vona, so war es im Grunde mit Ionesco, so war es mit Rotaru, und jetzt eben mit Stănilă. Vielleicht mehr als bei den drei Erstgenannten war es bei Stănilă, sodass ich mich mit ihr zum Teil selber übersetzt habe. Was ich damit meine: Es sind Schnittmengen der Themen, die wir beide haben, sie in ihrer Lyrik, ich in meiner. Und insofern fiel es mir auch nicht schwer – mit der Übersetzung von Moni Stănilă übersetze ich mich im Grunde selbst. Letztlich ist das Ziel immer auch Selbsterkenntnis. Und das sind so Etappen für mich, dieser Selbsterkenntnis näher zu kommen.
ED: Bevor wir auf diese Ähnlichkeiten ganz kurz noch zu sprechen kommen, würde es mich auch interessieren: Wenn Du so ein Herzensprojekt gerade anfängst, ist es Dir dann schon von Anfang an klar, dass daraus ein Band wird, suchst Du im Voraus den Verlag oder Du übersetzt zunächst mal für Dich, probeweise? Also wie gehst Du davor?
Übersetzungen als Herzensangelegenheiten
AB: Bei Moni Stănilă, um es sehr konkret zu machen … Ich bin beteiligt an einer Reihe Sprache im technischen Zeitalter, das ist die hauseigene Literaturzeitschrift des Literarischen Colloquiums Berlin. Und dort werden LyrikerInnen vorgestellt, von insgesamt vier Leuten inzwischen. Ich bin einer davon. Und so habe ich mit Moni Stănilă begonnen, ich habe erst einmal zehn Gedichte übersetzt für diese Reihe und dieses Dossier damals mit einer kurzen Einleitung versehen, und diese Einleitung ist jetzt Nachwort des Buches, also der deutschen Übersetzung des Buches von Moni Stănilă. Also es sind mehrere Etappen, und es gibt weitere Autoren aus dem rumänischsprachigen Raum, mit denen ich so umgegangen bin, woraus aber dann kein Buch entstanden ist. Also es muss nicht immer zum Buch kommen, ich habe ja nicht so viel übersetzt, wenn man sich das jetzt anschaut, insgesamt.
ED: Aber das machst Du ja auch wie gesagt nebenbei, und dafür, dass Du das nebenbei machst, hast Du eigentlich sehr viel übersetzt, also es ist eine Sache der Perspektive, wie ich das einstufen möchte. Und wenn wir schon vorher darüber gesprochen haben, dass es Ähnlichkeiten … Also immer, dass Du immer nach Anknüpfungspunkten suchst, oder von diesen Anknüpfungspunkten zu den Werken kommst. Bei Moni Stănilă und in Deiner Dichtung gibt es mehrere gemeinsame Punkte. Die lyrischen Welten ähneln sich oder treffen sich in mehreren Punkten. Ich denke zum Beispiel an das Thema des Sportes im Allgemeinen, aber ebenso an den Glauben, auch wenn die zwei Arten von Glauben schon sehr unterschiedlich sind, würde ich jetzt mal behaupten, trotz Analogien … Also dass Dich diese Welt oder dass Du dich in dieser lyrischen Welt von Moni Stănilă zu Hause gefühlt hast, das leuchtet mir ein. Mich würde interessieren, welche Schwierigkeiten sich dennoch bei der Übersetzung ergeben haben?
AB: Ja, genau. Zum ersten Teil Deiner Frage: Es sind bei Moni vier bis fünf Hauptthemen, die diesen Gedichtband dominieren. Du hast jetzt zwei genannt, die mich auch sehr betreffen, das ist der Glaube, das ist der Sport. Bei ihr kommt hinzu der Krieg in der Ukraine seit 2014 und dann seit 2022. Dann das vierte Thema bei ihr ist die fehlende Mutterschaft, der Kinderwunsch, der nicht verwirklicht wurde, werden konnte, und fünftens eine Literatur über Literatur. Das ist im Grunde auch mein Thema. Also drei von fünf Themen teilen wir. Und das war wichtig für mich bei der Entscheidung, diesen Band auch ganz zu übersetzen. Genau. Schwierigkeiten hatte ich nicht unbedingt viele.
ED: Das hat die Moni übrigens auch gesagt. Als ich gefragt habe, ob ihr viel konsultiert habt, da hat sie gemeint: Nein. Wir haben dann die einzelnen Themen, die Du jetzt auch aufgezählt hast – den Krieg, die Frage der Mutterschaft auch einzeln besprochen – und auch die Reflexion über Literatur in Literatur, also sozusagen die Metaebene. Und das hat sie eigentlich auch berichtet, dass es keine großen Schwierigkeiten gibt. Ich habe damals auch nach großen Diskussionen, wo Du den Text doch anders gelesen hast, gefragt.
Zugängliche Ästhetiken
AB: Nein, nein, also das ist diese Ästhetik … die Ästhetik dieser Gedichte, oder von Moni ist eine mittlere Ästhetik. Es ist nicht experimental und es ist nicht billig. Es ist eine Verständlichkeit gegeben, die es mir natürlich bei der Übersetzung leichter macht. Es wäre schwierig jetzt, Experimentalpoesie aus dem Rumänischen ins Deutsche zu bringen. Bei Moni ist dies nicht der Fall. Das Gehalt der Gedichte hält sich die Waage mit der von ihr eingesetzten Ästhetik. Es ist ein mittlerer Weg des Schreibens, der nicht so kompliziert ist zu übersetzen.
ED: Man kann aus dem, was Du jetzt erzählt hast, eigentlich mitnehmen, dass es Dir beim Übersetzen wahrscheinlich gar nicht daran liegt, was man sonst bei Übersetzungen oft hört, dass einer, der sonst auch Romane schreibt oder Autor ist und übersetzt, bei der Übersetzung sein Schaffen, das Ich ausschaltet. Wenn ich Dich richtig verstehe oder deute, dies ist bei dir nicht der Fall, gerade weil Du Herzensprojekte machst, auch in diesem Fall bei Moni. Die Ähnlichkeit der lyrischen Welt macht es nicht erforderlich, dass Du den Lyriker in Dir sozusagen ausschaltest bei der Übersetzung. Oder gehe ich da zu weit?
AB: Ich würde Dir recht geben. Also ich bin da recht unverkrampft. Du siehst, wenn du übersetzt, egal, wen du übersetzt, siehst vielleicht so leichte Schwächen und du kannst dann in der Übersetzung das Ganze aufwerten, leicht aufwerten. Aber nicht so, dass du das Original, jetzt in diesem Fall das Originalrumänisch veränderst. Manchmal kannst du bestimmte Sachen nicht wiedergeben, Du bleibst hinter dem Original, an anderen Stellen, kannst Du mehr machen als das Original. Und das kommt immer wieder vor, natürlich auch bei Moni, dass ich sozusagen Bestimmtes nicht wiedergeben kann, Bestimmtes viel besser wiedergeben kann mit den Mitteln der deutschen Sprache. Das kann vorkommen – jetzt habe ich keine konkreten Beispiele, um das jetzt zu verdeutlichen.
„Later edit“ und der Krieg
Womit ich Schwierigkeiten hatte … , es waren …, das ist jetzt aber fast schon banal, bestimmte Abkürzungen, die ich nicht verstanden habe, zum Beispiel in einem Gedicht: „l.e.“. Und es ist banal, aber über diese Nachfrage bei Moni ergibt sich dann eine Diskussion darüber und eine ganze Poetik und eine ganze Einschätzungsmöglichkeit des Bandes. Ich habe sie gefragt: „Moni, was bedeutet dieses „l.e.‘“hier in diesem Gedicht?“ Und sie sagte dann: Es bedeutet: „later edit“ Also das heißt, sie hat im Grunde nachdem das Gedicht fertig war, dem Gedicht etwas hinzugefügt. Und das ist ein Gedicht, das in diesem „later edit“ über das Massaker in Butscha spricht. Was ergibt sich aus dieser Nachfrage? Aus dieser Nachfrage ergibt sich die Perspektive des Gedichtbandes. Die Perspektive des Gedichtbandes ist keine Perspektive in der Retrospektive. Es ist letztlich in der Echtzeit des Krieges geschrieben worden, wo die schreibende Instanz gar nicht konsolidiert ist.
Ihr Affekthaushalt ist gar nicht konsolidiert, sondern es ist Wut da, es ist Trauer da, es sind viele Gefühle da. Und aus diesem Gefühlshaushalt wurden Gedichte geschrieben, und das finde ich sehr interessant. Das macht etwas mit dem Gedicht, wenn Du dir keine Zeit gibst, etwas wirklich zu verarbeiten über Jahre. Ja, also aus dieser Nachfrage ‒ „Was bedeutet dieses „later edit“? ‒ konnte ich mit Moni darüber sprechen, was dieser Perspektive auf den Krieg, auf die eigenen Leidenschaften wie den Fußball, den Glauben …, was der Krieg damit macht, wenn man sich noch während des Kriegs dazu äußert.
ED: Darüber haben wir mit Moni auch ausführlich gesprochen, was der Krieg mit ihrem lyrischen Ich gemacht hat, wie sie reagierte, und wie der zweite Teil des Bandes dann zustande kam bzw. wo er zustande kam. Ich würde noch kurz zum Punkt zurückkommen, den Du erwähnt hast, dass sich manches in der Übersetzung auch leicht verbessern lässt in gewissen Situationen. Ich habe Moni erzählt, dass mir persönlich der deutsche Titel des Bandes besser gefällt als der rumänische. Jetzt würde es mich interessieren: Welche waren die Optionen, kannst Du dich noch erinnern? Weil ich Metallische Igel wirklich sehr, sehr gelungen finde. Kannst Du dich an die anderen erinnern?
Metallische Igel im Krieg
AB: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz daran erinnern, aber ich kann sagen, dass mir diese Entscheidung für diesen Titel letztlich abgenommen wurde. Das hängt zusammen mit dieser Einführung, die ich für die besagte Reihe der Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter geschrieben habe. Und diese Einführung hatte ich damals Metallische Igel genannt. Das war der Titel, und ich habe den dem Verlag dem Manuskript und dem Begleittext geschickt. Am Ende hat mir der Verleger die Entscheidung abgenommen. Er hat gesagt, lass uns diesen Titel Metallische Igel nehmen und nicht das weniger anschauliche Ofsaid, also abseits für die Abseitsregel, wie der Band im Original heißt.
Ich fand den Titel deshalb ansprechend, weil er sozusagen den Akzent auf den zweiten Teil des Bandes legt. Ofsaid, Abseits, legt den Akzent auf das Vorhaben von Moni. Moni sollte ja ein Aufenthaltsstipendium wahrnehmen, dessen Beginn mit dem Beginn der Vollinvasion Russlands zusammenfiel. Während dieses Aufenthaltsstipendiums wollte sie einen Gedichtband über Fußball schreiben. Dann entwickelte sich das Ganze durch den Krieg zu etwas ganz Anderem, und insofern fand ich eben diesen neuen Titel für die deutsche Übersetzung ansprechend. Es ist eine Metapher für den Krieg. Man denkt: Metallische Igel, was könnte das sein? Könnte das eine Installation sein? Aber wenn man das entsprechende Gedicht liest, in dem diese Wendung vorkommt, dann wird man auch bald erfahren: Eigentlich verstecken sich hinter den metallischen Igeln die sogenannten „Tschechenigel“. Das sind Panzersperren. Das heißt, während des Krieges auf Straßen werden solche Sperren hingesetzt, damit Tanker, Panzer, andere Vehikel das Ganze nicht passieren können.
ED: Wir haben mit Moni auch darüber gesprochen, dass das Bild des Igels sehr gut zu ihrer lyrischen Welt und zu ihrem lyrischen Ich passt.
Übersetzung als Vermittlung
ED: Du bist bezüglich der Vermittlungsarbeit ein besonders gut geeignetes Beispiel, wenn ich das so sagen darf, in dem Sinne, dass Du den Band auch an das deutsche Publikum nicht nur sprachlich herangetragen hast, sondern auch in mehreren Formaten die Vorstellung ermöglicht hast. Ihr wart jetzt in den letzten Monaten mit mehreren Lesungen in Deutschland unterwegs: in Leipzig, Berlin, Frankfurt, in Berlin mehrmals. Welche Rückmeldungen habt ihr bei den Lesungen gehabt? Die letzten waren vor ein paar Wochen.
AB: Es waren sehr gute Rückmeldungen. Natürlich kann man das nicht immer so leicht unterscheiden, ist das jetzt Smalltalk nach der Veranstaltung oder Ähnliches. Aber die Leute haben zugehört und die Leute, die da waren, waren offen für diese Perspektive von Moni. Es ist eine Perspektive aus der Nachbarschaft des Krieges, aus Chişinău, aus der Moldau. Ich nehme schon wahr, dass es ein Publikum gibt, gerade in Deutschland, dass nach diesen Erfahrungen ja auch dürstet. Wir führen die Debatte über den Krieg aus der Distanz über die Medien. Wir haben als normale Bürger keine Anschauung dessen. Und bei Moni ist es anders. Moni konnte am Morgen des 24. Februar das Geknalle aus dem Nachbarland Ukraine hören. Das ist schon ein Riesenunterschied, wenn der Krieg akustisch, auditiv zu vernehmen ist. Das können wir uns hier gar nicht vorstellen, was das für Ängste auslösen kann. Und es ist sehr wertvoll, dass jemand wie Moni darüber berichten kann.
Zum Aspekt der Vermittlung: Sicherlich hatten wir auch sehr viel Glück dabei. Ich weiß nicht, warum das so erfolgreich sein konnte, weil mit Andra Rotaru, mit dem Band von Andra, Tribar, war es ja nicht so, leider.
ED: Die Lyrik-Empfehlungen haben wahrscheinlich auch mitgeholfen, dass es auf der Liste war, dieses Jahr.
AB: So ist es, die Lyrik-Empfehlungen waren sehr wichtig. Kerstin Preiwuß ist diejenige, die diesen Gedichtband Metallische Igel auf die Liste der Lyrik-Empfehlungen gesetzt hat. Sicherlich habe ich mit den Jahren auch dazu gelernt, wie manage ich die Wahrnehmung, die Rezeption einer Übersetzung, für die ich verantwortlich zeichne? Immer wieder darüber sprechen, immer wieder darauf hinweisen, dass es diesen Gedichtband gibt. Sagen auch, zum Beispiel … in Berlin letztes Jahr gab es dieses rumänische Festival von Frau Ciontos.
ED: Im Literaturhaus meinst Du …
AB: … im Literaturhaus. Die Organisatoren, die Macher:innen, immer wieder darauf hinweisen: Das wäre eine Möglichkeit, vielleicht ist das etwas für Dich, vielleicht möchtest Du diese Person mit diesem Band einladen und immer so weiter. Jetzt in Berlin, bei dem Poesiefestival Berlin, war es dann so: Alles war vorbereitet und dann fiel mir ein, eigentlich kennst du da jemanden bei der FAZ. Also du kennst da jemanden, die für die FAZ immer wieder diese Artikel schreibt mit dem Schwerpunkt Osteuropa, Südosteuropa usw. Also da war ich sehr punktuell. Da habe ich mir gedacht, du schreibst diese Person an und weist darauf hin, dass Moni Stănilă da ist, die eben diese Perspektiven bringt, die auch Thema dieser Journalistin sind. Und es hat einfach sehr gut geklappt, und ich freue mich riesig für Moni, dass das der Fall ist. Natürlich gehört dieser Vermittlungsinstanz, dass ich selber bin … Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, wie Ernest Wichner das macht: Bei Mircea Cărtărescu muss er nichts mehr machen, aber bei einer unbekannteren Person, wie geht er davor. Das weiß ich nicht. Gleichzeitig weiß ich, ich bin relativ gut vernetzt in der deutschen Lyrikszene und das hilft einer Übersetzung.
Gedicht 49
ED: Ganz sicherlich. Und es freut mich sehr, dass dadurch auch Moni Stănilă in Deutschland bekannt wird und ich hoffe, das setzt sich fort, diese Tendenz, die es jetzt gibt. In diese Richtung versuchen wir auch tätig zu sein, indem wir jetzt auch Podcasts zweisprachig machen, vielleicht hilft das, natürlich in begrenzten Rahmen. Aber ich würde jetzt vorschlagen, dass wir unser Gespräch mit einem Gedicht, das Du aus dem Band ausgewählt hast, unser Gespräch ausklingen lassen.
AB: Ja, sehr gerne. Es ist das Titelgedicht, sozusagen, denn in diesem Gedicht kommt die Wendung vor, die dann zum Titel der deutschen Übersetzung wurde. Und zwar die Wendung „metallische Igel“. Es ist das Gedicht 49 aus dem zweiten Teil des Gedichtbandes. Es gibt zwei Teile à 33 Gedichte und das wäre das Gedicht:
49.
Des Lebens heißen jetzt
die Züge, mit denen ich Odessa verließ nach meinem Geburts-
tag. Ich bekam eine Flasche Sekt geschenkt im Design Hotel
Skopeli,
sogar an der Meeresküste, in Lanjarón. Die Odessiten sind eine aparte
Spezies, sagte ich zu dir.
Es war seit einigen Jahren dein Geschenk für mich. Baden im Meer
ist mein Geschenk. Denn das Leben, die Jugend. Die metallischen Igel
auf der Derybasivska wirken wie überlagerte Photographien aus dem Doina-
Friedhof.
Wenn die Mütter
ihre Säuglinge in Bunkern stillen,
fahren die Züge des Lebens aus Odessa ab
mit jemandes Frauen,
mit jemandes Kindern.
Die Wellen des Schwarzen Meeres reichen höchstens sechs Meter hoch,
und ich habe lange Zeit geglaubt, dies, schau, sei
das Meer des Lebens.
Anstatt Delfine Kriegsschiffe.
ED: Vielen Dank für diesen lyrischen Ausklang und für Deine Zeit, und natürlich die Einblicke in Deine übersetzerische und vermittlerische Arbeit. Ich freue mich, das Gespräch über ein anderes Buch ein nächstes Mal fortsetzen zu können. Vielleicht über Deinen neuen Band, der gerade in Vorbereitung ist.
AB: Naja, also wirklich in Vorbereitung ist das nicht. Ich freue mich auf das, was kommt, auch was aus München von euch kommt. Ich finde diese Vermittlungsarbeit, die ihr leistet, großartig.
ED: Das freut uns natürlich sehr.
AB: Es fehlte so was und ihr seid da und das ist wichtig, und auch das Portal, das ihr führt, ist wichtig. Ich schaue immer wieder da drauf: https://zwischengrenzen.online/. Ich bedanke mich für die Einladung und wünsche vor allem weiterhin viel Erfolg mit diesem Podcast-Format.
ED: Das wünschen wir Dir auch: Viel Erfolg in Deiner lyrischen und übersetzerischen Tätigkeit! Wir freuen uns auf eine Fortsetzung in der Zukunft.
AB: Vielen Dank!