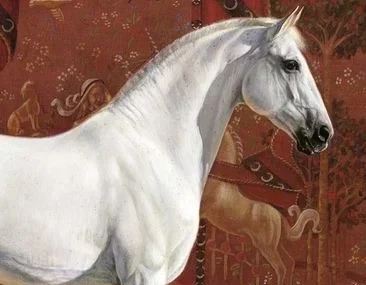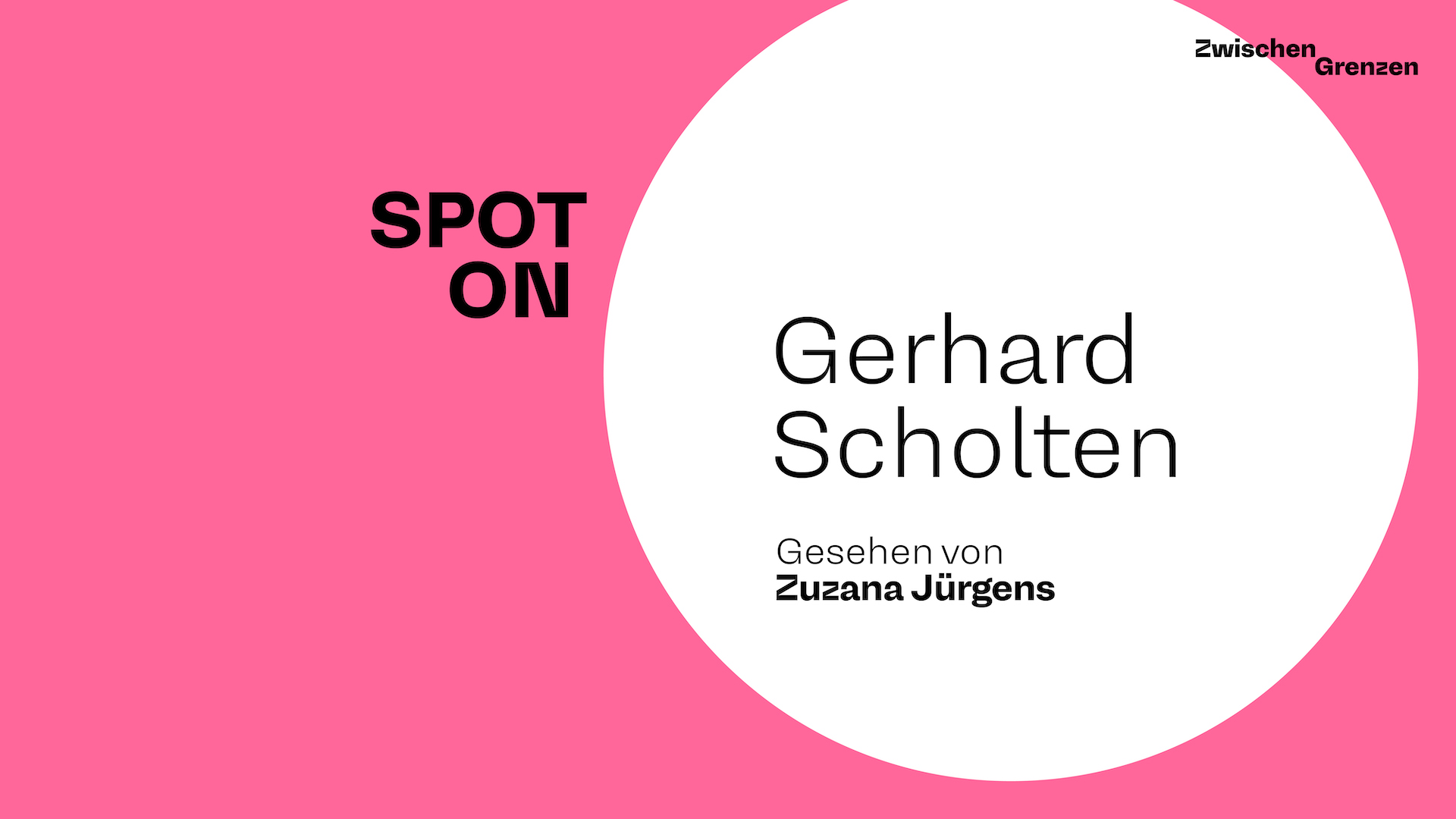Zwischen literarischem Feilen und ,,orientalischem Feilschen“. Kristiane Kondrat spricht über den Mentor Franz Liebhard
von IKGS München
Dr. Enikő Dácz spricht mit der Schriftstellerin, Lyrikerin und Journalistin Kristiane Kondrat über den Temeswarer Autor und Kulturvermittler Robert Reiter, alias Franz Liebhard, dessen Nachlass am IKGS im Rahmen eines vom Kulturwerk der Banater Schwaben und vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales geförderten Projektes archivalisch bearbeitet und zu Forschungszwecken sowie der interessierten breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
30. Oktober 2025Kristiane Kondrat erinnert sich an ihren Mentor Franz Liebhard, der sie in den 1960er-Jahren in den Temeswarer Schriftstellerverband eingeführt und zum „Feilen“ an literarischen Texten ermutigt hat. Sie spricht über die Empfehlungen und Ratschläge des Expressionisten, der sie an die Wiener Moderne herangeführt hat, und die gemeinsamen Erfahrungen in Temeswarer Literaturkreisen. Zudem geht sie auf das „orientalische Feilschen“ mit Zensoren und auch darauf ein, worüber man damals nicht gesprochen hat.
Kristiane Kondrat ist 1938 in Reschitza im Banater Bergland geboren, hat Germanistik und Rumänistik in Temeswar studiert und arbeitete anschließend als Kulturredakteurin bei der „Banater Zeitung“ in Temeswar. Seit 1973 lebt Sie in Deutschland und war als freie Journalistin tätig. Ihr erster Gedichtband „Regenbogen“ erschien 1968 im Bukarester Jugendverlag. 2019 veröffentlichten sie den Roman „Abstufung dreier Nuancen von Grau“ in 2. Auflage beim danube books Verlag in Ulm, ebenda erschien 2021 eine leicht überarbeitete 2. Auflage der „Vogelkirschen“ unter dem Titel „Bild mit Sprung“. 2023 folgte der Lyrikband „Wer tanzt im Niemandsland“. Zu ihren Auszeichnungen gehören der Förderpreis für Lyrik 2011 der Cité der Friedenskulturen (Lugano) sowie der Spiegelungen-Publikumspreis für Lyrik (Publikumspreis 2017). 2022 waren Sie für den Meraner Lyrikpreis nominiert.
Kulturwerk der Banater Schwaben
Musik: Clara Schumann, Scherzo No. 2, Op. 14; Klavier: Luis Sarro (Lizenz: CC0 1.0)
Den Podcast gibt es auch als Video auf YouTube und Spotify:
Spiegelungen. Wissenschaft. Literatur. Feuilleton.
CC-Lizenz: BY-NC-ND | IKGS 2025
Das Transkript zum Mitlesen
ED: Herzlich willkommen, liebe Kristiane. Danke, dass du die Einladung hier nach München angenommen hast. Es freut mich sehr, dich heute bei uns begrüßen zu dürfen. Anlass zu unserem Gespräch ist das Erschließungsprojekt, das wir zum Nachlass von Robert Reiter, alias Franz Liebhard, haben. Und dieses Projekt wird vom Kulturwerk der Banater Schwaben und vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Genaue Informationen für die Interessenten findet man auf unserer Projektseite, wo auch dieser Podcast und das Gespräch dann nachzuschauen ist.
Bevor wir ins Gespräch kommen, möchte ich dich ganz kurz vorstellen. Du bist 1938 in Reșița im Banater Bergland geboren, was für unser heutiges Thema von großer Relevanz ist – deswegen nenne ich das auch so präzise –, hast Germanistik und Rumänistik in Temeswar studiert und hast dann anschließend als Kulturredakteurin in Temeswar gearbeitet. Seit 1973 lebst du hier in Deutschland und warst als freie Journalistin tätig. Man kennt dich, sozusagen in unseren Spiegelungen-Kreisen, als Lyrikerin und als Schriftstellerin. Dein erster Gedichtband Regenbogen erschien 1968 im Jugendverlag in Bukarest. 2019 – da war eine lange Pause – veröffentlichtest du den Roman Abstufung dreier Nuancen von Grau in zweiter Auflage bei danube books in Ulm. Und ebenda erschien ‘21 eine leicht überarbeitete zweite Auflage der Vogelkirschen unter dem Titel Bild mit Sprung. Und 2023 erschien dein Lyrikband Wer tanzt im Niemandsland.
Zu deinen Auszeichnungen gehören der Förderpreis für Lyrik, 2011, der Cité der Friedenskulturen Lugano, sowie auch der Spiegelungen-Publikumspreis für Lyrik. Und 2022 warst du für den Meraner Lyrikpreis nominiert, um nur einige Punkte zu nennen.
Heute bist du als Schriftstellerin und Zeitzeugin unser Gast. Wie gesagt, wollen wir über Robert Reiter sprechen und ich würde gerne erzählen, wie es zu diesem Gespräch überhaupt gekommen ist. Ehrlicherweise habe ich mir bei diesem Projekt am Anfang gedacht, dass es schön wäre, wenn wir nicht nur eine Erschließungsarbeit leisten, sondern versuchen, die Persönlichkeit von Robert Reiter auch in die Öffentlichkeit zu bringen und dieses Leben da auch vorzustellen. Wir dachten, da kann man anlässlich der Aufarbeitung ein paar Gespräche auch führen. Und das erste Gespräch, das ich geführt habe, das war im Sommer mit einer Literaturwissenschaftlerin aus Klausenburg, Dr. Réka Jakabházi. Und da haben wir über Robert Reiter als Lyriker gesprochen, weil sich Frau Jakabházi mit ihm als Lyriker auseinandergesetzt hat.
Darauf kam eine E-Mail von dir, über die ich mich sehr gefreut habe. Du hast deiner Freude Ausdruck gegeben, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und du hast auch geschrieben, dass Robert Reiter für dich so was wie ein Mentor war. Da habe ich gedacht, ja super, das ist dann das zweite Gespräch, das sehr gut dieses erste Gespräch ergänzen wird, beziehungsweise die uns fehlende Zeitzeugenperspektive auch einbringt. Also das war die Vorgeschichte unseres heutigen Treffens. Nochmals danke, dass du die Einladung angenommen hast.
Ich würde vorschlagen, dass wir mit dem Beginn eurer Bekanntschaft mit Robert Reiter, alias Franz Liebhard anfangen. Wann und unter welchen Umständen hast du Robert Reiter – du hast ihn als Franz Liebhard – kennengelernt?
Von Dorflehrerin zu Kulturjournalistin
KK: Ja, also zuerst hat er mich kennengelernt. Ich hatte schon als Studentin einiges veröffentlicht dann in der Neuen Literatur, in der Banater Zeitung, damals hieß sie Die Wahrheit, in der Lokalpresse also, ist auch etwas zu mir erschienen. Ich war damals Lehrerin, in einem kleinen Dorf, in der Nähe der serbischen Grenze. Und ich bekam dann eines Tages eine Einladung nach Temeswar zum Schriftstellerverband, ich soll doch meine Texte lesen. Und da habe ich Franz Liebhard kennengelernt, für mich war er Franz Liebhard – ich wusste damals noch nicht, dass er privat Robert Reiter hieß – und er sagte zu mir, die Texte, die er von mir gelesen hat, die haben ihm sehr gut gefallen, und er möchte mehr von mir hören, und ich soll doch kommen, ich würde eingeladen.
Es war eine sehr schöne Atmosphäre beim Schriftstellerverband und ich wurde aufgenommen wie jemand, der dazugehörte, obwohl ich damals noch nicht dazugehört hatte, ich war eine Anfängerin, die einiges, einzelne Texte veröffentlicht hat, mehr nicht. Und ja, er hat mir dann zugehört, er hat meine Texte sich angehört. Darüber möchte ich dann später sprechen, was für Tipps er mir gegeben hat, in welche Richtung er mich geleitet hat. Und er wurde so eine Art Mentor.
Er sagte auch zu mir, der Schriftstellerverband würde sich dafür einsetzen, dass ich nach Temeswar komme und da in der Redaktion arbeite. Also er sagte zu mir: „Ihr Platz ist nicht in einem kleinen Dorf an der serbischen Grenze, Ihr Platz ist hier in Temeswar. Da ist das kulturelle Zentrum, und hier können Sie sich weiter entfalten.“ Und das hat geklappt. Ich kam zur Redaktion, das habe ich auch Herrn Reiter zu verdanken, bzw. Franz Liebhard. Damals war er für mich Franz Liebhard. Ich habe gehört, dass seine Freunde und ältere Kollegen immer „Robert“ zu ihm gesagt haben. Und ich habe mich gefragt, warum sagen die alle Robert? Der heißt doch Franz. Später habe ich gehört, dass er privat also Robert Reiter heißt und Franz Liebhard sein Pseudonym sei. Ja, so habe ich ihn kennengelernt, beim Schriftstellerverband. Das war am St.-Georgs-Platz in Temeswar.
ED: In welchem Jahr sind wir so ungefähr?
KK: Das war so Mitte der 60er-Jahre, Anfang/Mitte der 60er-Jahre.
ED: Und wie lange warst du Lehrerin in diesem Dorf an der Grenze?
KK: So eineinhalb Jahre. Ich wurde da durch diese „repartizare“ [Zuteilung] hingeschickt, weil ich in Temeswar Freunde und meinen Freund hatte. Und ich wollte in der Nähe von Temeswar sein, aber ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Ich habe da auch ein Gedicht geschrieben, zu dem ich später kommen möchte, und auf das sich auch Franz Liebhard dann bezogen hat bei den Besprechungen.
Beim Schriftstellerverband waren das so Werkstattgespräche. Da hat immer jemand vorgelesen; die Kollegen haben sich dazu geäußert; es wurden Fragen gestellt; der Autor hat geantwortet. Es waren lockere Gespräche, richtige Werkstattgespräche, die dem Lesenden etwas gebracht haben. Und es hat mir viel, viel gebracht, was vor allem Franz Liebhard gesagt hat.
ED: Das heißt, du wurdest zuerst eingeladen. Da warst du bei einer ersten Lesung. Und nach diesem ersten Mal bist du dann regelmäßig zur Werkstatt gegangen? Also monatlich, oder wie sollen wir uns das vorstellen?
KK: Ich war öfters da. Es ist lange her, ich kann mich nicht genau erinnern, wie oft und wann, aber ich war öfters da, noch bevor ich Mitglied im Schriftstellerverband wurde. Das wurde ich erst, nachdem mein erstes Buch erschienen war. Ich war aber öfters da, und ich wurde immer gleich behandelt mit allen anderen Kollegen, die bereits Vollmitglieder waren.
ED: Und du warst am Anfang sozusagen Gast aus dem Umland.
KK: Ich war Gast, ja.
Journalistische Erfahrungen
ED: Nach ungefähr anderthalb Jahren bist du nach Temeswar gekommen in die Redaktion.
KK: Ja, ab ‘65 war ich in der Redaktion, und ich kann mich an meinen ersten Artikel erinnern. Das hatte auch einen Zusammenhang mit Franz Liebhard: Er war Dramaturg beim Deutschen Staatstheater damals, beim Temeswarer Staatstheater, nd mein erster Artikel war ein Portrait. Ich sollte über eine Temeswarer Schauspielerin schreiben. Das Theater war nicht weit, so gleich um die Ecke. Ich bin da hin, habe geklingelt, wer macht mir auf? Herr Liebhard. Er hat gewusst, warum ich komme und sagte …, er wusste auch, dass ich immer Lampenfieber hatte. Denn ich hatte immer, bei jedem Werkstattgespräch beim Schriftstellerverband Lampenfieber, das hat er ja gemerkt. Und da hat er gesagt: „Brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Das ist ein ganz nettes Mädel, sie wird Ihnen viel erzählen.“ Und das war auch so, sie hat mir viel erzählt. Sie war schon einigermaßen bekannt und hat auch Hauptrollen gespielt, war eine junge Schauspielerin. Das war ein guter Artikel und mein Einstieg, mein erster Artikel in meiner journalistischen Arbeit. Ja, und da war auch Franz Liebhard dabei.
ED: Wie wurde er in der Redaktion … er war nicht Mitarbeiter, sondern arbeitete sozusagen als freier Mitarbeiter mit, schrieb Artikel. Wie wurde er in der Redaktion wahrgenommen? War er oft da? Wie gestaltete sich diese Zusammenarbeit? Natürlich aus Ihrer Perspektive?
KK: Er war öfters da, nicht oft, nicht jeden Tag. Wenn etwas erschienen ist von ihm, er hat ja eine Reihe von Reportagen geschrieben, zur Temeswarer Stadtgeschichte. Dann ist er immer in die Redaktion gekommen, hat die Zeitung genommen, hat sie gelesen und hat sie mitgenommen. Er hat seine Zeitung genommen und war manchmal enttäuscht. Darüber möchte ich auch später sprechen.
ED: Das können wir gerne jetzt … Warum war er enttäuscht?
Die Suche nach der Wahrheit zwischen Geschichte, Politik und Zensur
KK: Ja, da muss ich ein bisschen weit ausholen. Das war zu jener Zeit, als dieser rumänische Nationalismus kommunistischer Prägung schon seine Schatten vorausgeworfen hat. Und es durfte nicht sein, was den Behörden nicht gefiel. Das durfte nicht sein. Die habsburgische und k. u. k-Vergangenheit des Banats und Temeswars, das durfte nicht so oft erwähnt werden. Man konnte sie nicht ganz streichen aus der Geschichte, aber es war unliebsam, darüber zu sprechen. Man hat ja an manchen Stellen die Geschichte verfälscht und rückwirkend umgeschrieben, das hat man auch getan. Es waren viele Behauptungen da, was alles das glorreiche rumänische Volk vollbracht hätte.
Gut, vieles wurde vollbracht.
Aber vor allem die langen Kämpfe gegen die Osmanen und gegen die osmanische Unterdrückung, aber die Befreier waren ja letztendlich die Österreicher, die haben uns befreit. Das waren nicht die Okkupanten, wie es manche haben wollten, die waren die Befreier.
Es sind auch viele rumänische Bauern aus Oltenien rübergelaufen über die Grenze, weil sie in Freiheit leben wollten, weil sie nicht unter der Osmanischen Herrschaft bleiben wollten. Die wollten ihre Kultur weiterleben, die wollten ihre Religion weiterleben, die wollten frei leben, ohne unterdrückt und ohne massakriert zu werden. Deshalb sind sie haufenweise, wirklich eine große Masse … Die nennen sich noch immer „Bufenen“, die sogenannten „Bufenen“ [rum. Bufeni]. Das sind rumänische Bauern, die aus Oltenien gekommen sind. Damals gehörte Oltenien noch – sowie die beiden rumänischen Fürstentümer – noch zum Osmanischen Reich. Wie gesagt, das wollte man nicht wahrhaben, dass Österreich dieses Stückchen Erde da befreit hat von diesem Osmanischen Reich. Das wollte man nicht haben, wahrhaben.
ED: Ganz wichtig ist, dass das Banat eigentlich dann Wien direkt auch untergeordnet blieb lange Zeit. Dieser direkte Kontakt hat natürlich das kulturelle Leben langfristig geprägt, also lange auch über die Zeit hinaus, die k. u. k.-Zeit hinaus.
KK: Ja, ja, sicher.
Diese Geschichten, diese … Robert Reiter schrieb ja über einzelne Gebäude, z.B. das Dikasterialgebäude… Also, jedes Gebäude, wie es entstanden ist, wer der Architekt war. Und das sind alles … Die Stadt wurde aufgebaut von den Habsburgern.
ED: Dazu passt sehr gut das Buch, das ich mir diese Tage nochmal angeschaut habe, Temeswarer Abendgespräch von Franz Liebhard. Hier sind eigentlich genau solche Texte, solche Essays gesammelt, wo es um das kulturelle Leben von Temeswar geht, und natürlich werden kulturhistorische Perspektiven da aufgearbeitet. Das ist eine Sammlung, die man auch heute mit viel Genuss durchblättern kann. Es sind Einzelaufsätze.
Aber kommen wir zurück. Er war mit manchen Artikeln, so wie sie abgedruckt wurden, nicht ganz zufrieden.
KK: Ja, das war eine ganze Serie von Reportagen zu der Geschichte der Stadt Temeswar. Und Franz Liebhard war ein Kenner der Temeswarer Stadtgeschichte. Er war die Koryphäe.
ED: Das bildet sich auch im Nachlass ab, wenn ich da jetzt dazu ergänzend sagen kann. Also sehr viele Studien, sehr viele Materialien und Unterlagen, die er gesammelt hat, alte Karten, aber auch Tagebücher, auch aus dem 19. Jahrhundert eines, sind da auch aufbewahrt, die dann eine sehr wertvolle Materialsammlung ergeben.
KK: Ja, er war ein Kenner Temeswars. Er hat seine Stadt geliebt, er ist ja gebürtiger Temeswarer, er hat die Geschichte gut gekannt, und er hat die Reportagen so geschrieben, wie es historisch auch belegt ist. Das hat aber den Behörden nicht gefallen. Wie gesagt, der rumänische Nationalismus hat damals schon seine Schatten vorausgeworfen. Es ist später noch schlimmer geworden.
Feilschen um jeden Satz
ED: Und wie ging er mit dieser Art von Zensur um?
KK: Ja, es wurden eigentlich Teile gestrichen. Ich kann mich erinnern, es war mal in der Druckerei, da war immer ein diensthabender Redakteur und ein „heller Kopf,“ also zwei Journalisten, die bis am Morgen dablieben, bis die Rotationsmaschine angelaufen ist. Wir hatten viel zu sprechen und zu feilschen mit dem Zensor. Der Zensor war oben im Obergeschoss. Das war ein Bekannter, ein Temeswarer, auch ein Deutscher, aber … ein ehemaliger Kommilitone, und wir haben also mit ihm auch verhandeln können.
Man hat gesagt: Bitte, das können wir bringen.
– Nein, nein, sagt er, da kriege ich Schwierigkeiten. Tut mir leid, das müssen wir ändern, das müssen wir streichen.
– Aber das ist doch so geschichtlich bewiesen.
– Ja, aber da krieg ich trotzdem Schwierigkeiten.
Und so ging das hin und her. Das war mitunter wie auf einem orientalischen Basar, dieses Feilschen. Um jedes Wort hat man da kämpfen müssen.
ED: Wer war bei diesen Zensurgesprächen dabei?
KK: Also die Redakteure, die damals … und der Zensor in der Druckerei.
ED: Also drei, vier Personen?
KK: Drei Personen.
Also ich war damals „heller Kopf“. In einer Nacht war ich dabei., als Franz Liebhard gerade eine Reportage im Kasten hatte, die erscheinen sollte. Ich weiß nicht mehr, wer diensthabender Redakteur war, das war immer ein Ressortchef, also Abteilungschef von der Kultur. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber an diese Nacht in der Druckerei kann ich mich erinnern, es gab Diskussionen um Diskussionen, das war ein Feilschen… Und wir wussten ja, dass der Franz Liebhard sehr enttäuscht sein würde und, dass er immer sehr traurig war, wenn man ihm ins Metier gepfuscht hat. Das wollten wir auch verhindern, aber wir konnten es nicht immer verhindern. Also es waren Dinge, die den Behörden nicht gefallen haben: Die wollten nicht zu viel Habsburger und k. u. k.-Geschichte in Temeswar, aber die gab es eigentlich. Das ist geschichtlich bewiesen, die gab es.
Die Enttäuschung des Journalisten Franz Liebhard
ED: Und als er das Blatt, die Zeitung in der Hand hielt, hat er sich irgendwie dazu geäußert? Oder hat man das im Stillen zur Kenntnis genommen? Habt ihr je darüber gesprochen?
KK: So genau weiß ich das nicht, er war ja nicht immer in der Kulturabteilung. Er hat auch manchmal mit dem Chefredakteur gesprochen. Was die hinter verschlossener Tür gesprochen haben, weiß ich nicht. Das weiß niemand. Vielleicht haben sie gestritten. Vermutlich − ich weiß es nicht. Vielleicht hat Franz Liebhard ihm Vorwürfe gemacht.
Aber die Redakteure, die konnten nichts tun. Wenn der Zensor gesagt hat, bis dahin und nicht weiter, dann ging es nicht weiter. Und er war enttäuscht, er hat gesagt … Einmal habe ich ihn gesehen, zufällig. Ich weiß nicht, an welchem Tag das war. Es muss nicht unbedingt der Tag gewesen sein, nach dieser Druckereinacht. Aber … er liest seinen Artikel, hat’s dann zusammengefaltet, in die Tasche gesteckt und ist mit steinernem Gesicht weggegangen. Und dann haben wir gewusst, dass er wieder enttäuscht ist. Und er hatte nicht so … Er hat einmal, glaube ich, gesagt: „Na ja, schon wieder“. So etwas in diesem Sinne. Manchmal war er in der Kulturabteilung, aber meist war er beim Chefredakteur. Und wie gesagt, er war öfters bei uns. Er war nicht glücklich darüber, dass man ihm etwas aus seiner Reportage weggestrichen hatte.
ED: Du hast mit ihm in der Redaktion oder wegen der Redaktionsarbeit dann hier und da punktuell zu tun gehabt, aber du hast mit ihm dann parallel in Literaturkreisen, bei Literaturveranstaltungen – er war auch Ehrenvorsitzender des Adam-Müller-Guttenbrunn-Kreises … Wie gestaltete sich da die Kooperation zwischen euch? Welche Rolle übernahm er in diesen literarischen Kreisen?
In die Moderne mit dem Mentor
KK: Ich habe mit ihm in der Redaktion nicht kooperiert, er hat alles besprochen mit den Chefs, mit dem Chef der Kulturabteilung − ich habe in der Kulturabteilung gearbeitet, aber als freie Redakteurin, ich war kein Ressortchef,− oder mit dem Chefredakteur, da habe ich nichts zu tun gehabt mit Besprechungen.
Aber literarisch. Er war im Schriftstellerverband, natürlich, und ich war, wie gesagt, immer wieder Gast im Schriftstellerverband, auch bevor ich Mitglied wurde. Und da waren auch alle … Ich kann mich erinnern, Zoltán Franyó war auch dabei, sie waren gut befreundet. Zoltán Franyó hat einige Gedichte von mir ins Ungarische übersetzt, sie sind in der Temeswarer ungarischen Zeitung erschienen.
Es waren wirklich kollegiale, manchmal heftige, aber gute Gespräche. Er hat mir wirklich sehr gute Tipps gegeben, er hat mir Anleitungen gegeben, und er hat etwas gesagt, was ich mir gemerkt habe. Er sagte eines Tages zu mir, nachdem ich gelesen habe: „Das kommt aus Ihnen heraus wie aus einem Vulkan und sprudelt und sprudelt. Und Bilder und Bilder und immer wieder Bilder.“ Dann macht er eine Pause und sagt: „Ab und zu müssen Sie auch ‚feilen’.“ Das habe ich mir gemerkt und seitdem bin ich ständig am „Feilen“. Natürlich wusste ich, dass man feilen muss, aber ab und zu muss man vielleicht öfters.
ED: Hast du ihm vor Veröffentlichungen auch Texte zur Begutachtung gegeben?
KK: Nein, das nicht. Das hatte ich, als ich Studentin war, meinem Professor, der sie dann an die Neue Literatur … Also, ich habe sie halt geschickt, wir haben zusammen ausgesucht. Robert Reiter/Franz Liebhard hat sich die Texte angehört, aber bei der Lesung, bei dem Werkstattgespräch im Schriftstellerverband. Da hat er die Texte gelesen. Und natürlich hat er auch die gelesenen, die in der Neuen Literatur erschienen sind. Er mich gut angelernt, er hat mich geleitet in Richtung Moderne. Er hat mir seine Vorlieben, seine Lieblingsautoren genannt, die ich mir als Beispiel nehmen, die ich unbedingt lesen sollte. Das war Georg Trakl, René Schickele, Claire und Yvan Goll. Das waren all die Expressionisten, die Moderne, die Wiener Moderne. Er hat sehr viel geschwärmt, auch von Robert Musil: Was für wunderbare Sätze Musil … Und ich sollte Mann ohne Eigenschaften lesen. Als ich nach Deutschland kam, habe ich mir Mann ohne Eigenschaften gekauft und gelesen. Also, in die Richtung hat er mich irgendwie geleitet, in die Moderne.
Die Deportation als offenes Geheimnis
ED: Du sprachst ja am Anfang über Liebhard, und ich über Robert Reiter. Ich nehme ihn als Robert Reiter wahr und du nimmst ihn als Franz Liebhard wahr. Wir kennen die Geschichte, warum er sich den Namen nach der Deportation zugelegt hat oder ihn sich angeeignet hat. Wann hast du die Geschichte, seine Deportationsgeschichte, erfahren?
KK: Man besprach zu jener Zeit immer alles privat unter vorgehaltener Hand. So habe ich erfahren, dass er auch deportiert war. Mein Vater war deportiert, mein Onkel war deportiert, die ganze Generation war deportiert. Er war die Generation meiner Eltern. Ja, er war … Ich habe es so unter anderem erfahren und es hat mich auch nicht gewundert, denn es wurden alle deportiert. Alle. So viele meiner Familienangehörigen, so viele Nachbarn waren deportiert worden, in Reschitz, in Temeswar, so viel Bekannte … „Dein Vater war auch deportiert, deiner auch, ja? Liebhard war auch.“ So ungefähr, so nebenbei hat man gewusst, ja, er war auch. Aber man hat nicht darüber gesprochen.
Das war ein Tabuthema, man sprach nicht darüber. Darüber hat man geschwiegen. Und ich habe auch nie, natürlich … Und er hätte auch wahrscheinlich nie darüber gesprochen. Ich hätte auch nie den Mut gehabt, ihn zu fragen, weil ich wusste, es war gefährlich, solche Fragen zu stellen.
ED: Dann habt ihr auch über seine politischen Gedichte nicht gesprochen, gehe ich mal davon aus.
KK: Nein, nein, nein, nein.
Und wenn wir sagen, ja, Mentor, natürlich, er war Mentor. Ich habe ihn mehr als Mentor kennengelernt. Und diese Literatur, er stand ja auch Pate bei dem ersten Literaturkreis, Nikolaus-Lenau-Literaturkreis… Als ich zur Redaktion kam und in Temeswar gewohnt habe, da durfte ich diesen Kreis leiten und organisieren. Das war einer für junge Studenten, nicht nur für Studenten, für junge Schreibende. Es kamen hauptsächlich Studenten. Wir trafen uns an jedem Wochenende im Studentenkulturhaus in der Josefstadt. Und ja, das war einige Jahre, das war schön, ich habe schöne Erinnerungen daran. Das hat auch ursprünglich Franz Liebhard initiiert.
Ich habe gehört, er war auch später für andere Generationen von Autoren Mentor. So als Mentor kenne ich ihn als Expressionist. Er hat mich, wie gesagt, in die Richtung gelenkt. Über seine propagandistischen Gedichte hat man auch nicht gesprochen. Man hat sie zur Kenntnis genommen.
Es war so in der Zeit: Das war so Usus damals in Rumänien, dass die Behörden, also dass man … die Kreispartei, Kommitee oder wer auch immer, bei bekannten Autoren – und Franz Liebhard war ja ein bekannter, prominenter Autor –Loblieder auf den „Conducător“ [„Führer“], auf die kommunistische Partei bestellt. Man hat diese Texte bestellt. Und wenn ein Autor nein gesagt hat, dann hat er seine Karriere dadurch gefährdet, manchmal auch den Brotberuf. Man konnte sehr schnell arbeitslos werden. Das war so, das war ein offenes Geheimnis mit diesen Bestellungen.
Ich bin fest überzeugt, – man hat nie darüber gesprochen, aber ich bin fest überzeugt− dass Franz Liebhard diese Texte nie, nie aus eigenem Antrieb geschrieben hat. Und vielleicht auch nicht ganz freiwillig. Das ist meine Überzeugung.
ED: Also … ich glaube, das können wir jetzt im Nachhinein auch schwer entscheiden.
Mich würde aber sehr interessieren, wie du … Also hast du seine Tendenzliteratur dann gelesen? Oder das wurde einfach ausgeklammert? Das habt ihr nicht wahrgenommen, weil er hat schon sehr viele Gedichte geschrieben, auch über das Proletariat und so weiter. Also, das war einfach kein Thema?
KK: Ja, man hat sie gelesen, man hat sie zur Kenntnis genommen; man hat nicht darüber gesprochen.
Zwischen den Kulturen
ED: Er hatte eine sehr wichtige Vermittlungsrolle, darüber haben wir schon gesprochen, zwischen ungarischen, rumänischen und deutschen Kreisen. Habt ihr bei euren … Hat er diese Rolle auch in den Literaturkreisen irgendwie gespielt? Hat er euch zu Übersetzungen ermuntert oder gab es auch in diese Richtung eine Tätigkeit, dass ihr auch zu dieser Vermittlungsrolle motiviert wurdet?
KK: Ich kann mich daran nicht erinnern. Nein, nein, das war nicht der Fall. Also wir haben nur im Kreis … Das war der deutsche Literaturkreis. Natürlich kamen da auch andere, die Deutsch sprachen und schrieben. Der Zoltán Franyó war jedes Mal dabei, ein ungarischer Schriftsteller, ein sehr bekannter. Wie gesagt, er hat auch einige Texte von mir ins Ungarische übersetzt.
ED: Aber was ich meine: Waren bei diesen Treffen auch rumänische Autoren von Zeit zu Zeit dabei, ungarische? Oder waren da nur deutschsprachige?
KK: Es waren nur deutschsprachige. Zoltán Franyó war auch deutschsprachig, aber multikulturell, er konnte alle Sprachen wie Franz Liebhard.
ED: Aber es gab dann nicht auch Schriftsteller aus deiner Generation, die, sage ich mal, ungarischsprachig oder rumänischsprachig gewesen wären und mitgemacht hätten?
KK: Nein, die haben … Die Rumänischsprachigen hatten ja die Zeitschrift Orizont, die war da auch beim Schriftstellerverband im gleichen Gebäude. Sie hatten ihre eigenen Werkstattgespräche. Und wir hatten unsere eigenen Werkstattgespräche.
Was wir gemeinsam hatten, waren Lesungen. Wir sind auch in die Dörfer gefahren, in andere Ortschaften, rumänische, deutsche, ungarische, und haben jeder in seiner Sprache gelesen.
ED: Wie oft gab es solche Lesungen? Also schon regelmäßig…?
KK: Ja, es waren schon einige. Wir sind rausgefahren mit so einem Kleinbus, und da waren wir gemischt. Da waren rumänische…
ED: Das war dann in Kulturhäusern?
KK: Ja, das war in den Kulturhäusern, vor allem da. Es waren rumänische Kollegen, deutsche, ungarische.
ED: Und diese gemeinsamen Lesungen wurden dann von Reiter organisiert?
KK: Nein, vom Schriftstellerverband. Also, er war in der Leitung des Schriftstellerverbandes, aber es waren mehr jüngere Autoren, die da rausgefahren sind. Wir haben uns gesehen und gesprochen, also ausschließlich, fast ausschließlich im Schriftstellerverband bei den Werkstattgesprächen.
Und da habe ich auch festgestellt, dass er sehr viel Empathie hat. Er konnte sich sehr gut hineinversetzen in die Gedankenwelt und in die Gefühlswelt anderer Autoren. Ich kann mich erinnern an ein Gedicht, das ich da vorgetragen habe. Ich war damals eine Zeit lang da in diesem kleinen Dorf in der Ebene und für mich war … Zum ersten Mal habe ich die Ebene gesehen. Also ich habe entweder in einer Stadt gewohnt oder in den Bergen. Das war ein bisschen beängstigend für mich, ein Gefühl der Verlorenheit, das ich auch in einem Gedicht wiedergegeben habe.
Und da war ein Kollege, ich weiß nicht mehr, wer das war, der hat mich gefragt, wieso ist das so, wieso fühle ich so eine Bedrohung in der Ebene? Es hat doch jede Landschaft ihre Reize. Ich sagte: Ja, natürlich hat jede Landschaft ihre Reize, aber ich betrachte, ich empfinde es als Bedrohung, wenn alles leer ist, kein Hügel, nur einzelne Bäume. Da ist Robert Reiter, bzw. Franz Liebhard eingesprungen. Er hat gesagt: Ja, er kann das gut verstehen, ein Mensch, der aus den Bergen kommt und in der Ebene steht, der kann diese Ebene als Bedrohung empfinden, er kann sich verloren fühlen, der findet keinen Halt. Das ist etwas Ungewohntes, das ist wie eine Landung auf einem fremden Planeten. Ich habe mir gedacht, genau das wollte ich sagen. Und er hat genau das gesagt, was ich in meinem Gedicht eigentlich ausgedrückt habe. Ich interpretiere nicht gerne meine eigenen Texte, aber er hat das sehr gut gekonnt.
ED: Deswegen war er auch ein sehr guter Mentor ….
Ich würde gerne noch abschließend die Frage stellen, ob du nach deiner Ausreise nach Deutschland noch Kontakt mit ihm hattest, in irgendeiner Form?
In Deutschland – Erinnerungen an den Mentor
KK: Nein, ich hatte mit niemandem mehr Kontakt.
Das war ja … Die Wende in Rumänien kam erst spät. Ich bin früh weg, ‘73. Die Wende in Rumänien kam erst Ende der 80er.
ED: ‘89, ja, als er gestorben ist.
KK: Ich habe das nur erfahren, als wir uns mal getroffen haben, unsere Studiengruppe. Wir hatten ein Klassentreffen, und da hat ein ehemaliger Kommilitone gesagt, der Robert Reiter ist gestorben. Er hat auch erzählt, er war beim Begräbnis. Wir haben über ihn gesprochen. Damals war mein erster Roman im Stuttgarter Verlag erschienen, Ende der 90er-Jahre. Wir haben darüber gesprochen, dass Liebhard mein Mentor war und, dass er mir sehr viel geholfen hat. Dann hat – der Jasz Walter [Journalist beim Neuen Weg in Bukarest, Anm.d.Red.] war das, der hat damals noch gelebt –, der hat mir gesagt, dass der Robert Reiter gestorben ist.
Ich hatte keinen Kontakt, und man konnte auch keinen Kontakt haben.
ED: Er ist gerade vor der Wende ‘89 verstorben.
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass in unseren Spiegelungen im Dezemberheft auch einige Briefe aus seiner Deportationszeit erscheinen werden. Eine Auswahl mit zwei Gedichten, die er aus der Zeit der Zwangsarbeit in der Sowjetunion an die Familie geschickt hat.
Die Briefe und den ganzen Nachlass verdanken wir Helga Ciulei, also Helga Reiter, die den Nachlass uns eigentlich übergeben hat.
Wenn es deinerseits noch etwas gibt, was du gerne ergänzen möchtest, können wir das an dieser Stelle noch tun. Ich weiß nicht, ob das Bild, das wir sozusagen geschildert haben, … ob es da noch irgendwelcher Ergänzungen deinerseits bedarf.
Piff-paff-Gedichte
KK: Also, was seine Tochter betrifft, die habe ich auch kennengelernt. Zum ersten Mal gesehen und auch zum letzten Mal – sie war ja in Bukarest bei der Neuen Literatur, und ich hatte ja da immer wieder Texte in der Neuen Literatur …
ED: Darf ich noch ganz kurz zur Neuen Literatur etwas sagen, was für die Zuhörenden interessant sein könnte? Robert Reiter war so etwas wie der Spiritus Rector eigentlich für die Neue Literatur, für das Vorgängerorgan noch im Banat. Es hieß Banater Stiftung, glaube ich, die erste Zeitung. Er spielte auch in dieser Hinsicht eine Schlüsselrolle. Das wollte ich nur ergänzen zur Neuen Literatur.
KK: Ja, das habe ich gehört. Er hat das auch initiiert, er hat sehr vieles initiiert.
Und seine Tochter, die war mal eines Tages auf Besuch bei uns, damals hieß sie noch Helga Reiter. Ich habe sie gefragt, ich hatte vorhin … Es sind einige Gedichte von mir erschienen in der Neuen Literatur, aber nicht alle. Ich hatte, glaube ich, fünf oder sechs … jedenfalls, eines ist nicht erschienen. Genau das, was mir am besten gefallen hat. Dann habe ich sie gefragt, warum das nicht erschienen ist. Sie sagte, sie hat so einen Zeigefinger … das ist so wie ein Revolver, da sagte sie: „Das ist ein ‘piff-paff-Gedicht’. Da hätten wir Schwierigkeiten bekommen, und Sie hätten auch Schwierigkeiten bekommen.“ Da habe ich nachgedacht, sagte: „Ja, wenn die das genau gelesen hätten, schon.“ Ob der Zensor das so genau … Da hab ich an den Zensor von der Zeitung denken müssen. Ich weiß nicht, was für ein Zensor in Bukarest war, was für Zensuren die hatten. Ja, das ist … Da hat sie recht gehabt, ja.
ED: Danke für diese Ergänzung zu Helga Reiter, später Ciulei.
Ich danke ganz herzlich noch einmal für diesen Rückblick auf eine Zeit, die meiner Generation nur aus Büchern bekannt ist, und für den Rückblick auf eine vielfältige Persönlichkeit, die als Vermittlerfigur und Grenzgänger das kulturelle Leben in Temeswar sehr langfristig geprägt hat bzw. über eine sehr lange Periode. Danke nochmals.
KK: Ich bedanke mich auch.